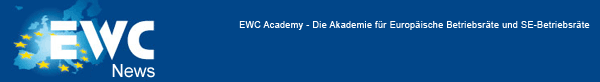 |
| Download als PDF | Newsletter-Archiv |
| This newsletter in English | Cette newsletter en français |
1. Deutliche Forderungen an den Gesetzgeber |
 |
|
Probleme mit der EBR-Richtlinie auf den Punkt gebracht
Der EGB bemängelt, dass die Zahl der Europäischen Betriebsräte durch die reformierte Richtlinie von 2009 nicht nennenswert gestiegen ist. Erst ein Drittel aller Unternehmen, die unter die Richtlinie fallen, verfügen über einen EBR. Neu in dem Positionspapier ist der klare Hinweis auf die Digitalisierung der Wirtschaft, die nach Meinung des EGB eine stärkere Beteiligung durch die Europäischen Betriebsräte erfordert. Die wichtigsten Punkte des Positionspapiers:
Das Positionspapier im Wortlaut Dossier zur Rolle Europäischer Betriebsräte bei Restrukturierungen Zeitschriftenbeitrag über die aktuelle EBR-Landschaft
Wie werden die Arbeitgeberverbände reagieren?
Waren Resolutionen der europäischen Gewerkschaften in der Vergangenheit mit allgemeinpolitischen Forderungen gefüllt, bringt dieses Papier die Themen so exakt auf den Punkt, dass bei Arbeitgebern sämtliche Alarmglocken läuten müssen. Das Management transnationaler Unternehmen wird in seiner alleinigen Entscheidungshoheit in Frage gestellt. In Deutschland spricht man von "Mitbestimmung", in angelsächsischen Ländern von "Stakeholder Economy". Künftig wird es dann nicht mehr ausreichen, strategische Planungen wie in einer "Kinovorführung" den Mitgliedern eines Europäischen Betriebsrats zu präsentieren, wenn am Ende harte Sanktionen drohen. Sollten diese Forderungen des EGB vom Gesetzgeber aufgegriffen werden, sind für die Arbeitgeberverbände sicher rote Linien überschritten. Die Diskussionen werden wohl ähnlich verlaufen wie in Frankreich, wo im Januar 2014 gesetzliche Fristen für das Konsultationsverfahren eingeführt wurden (siehe Bericht in den EBR-News 1/2014). Deutsche Bundesregierung soll Mitbestimmung ausbauen
Am 10. Februar 2017 forderte der Deutsche Bundesrat, die durch Digitalisierung und Globalisierung entstandenen Lücken im Recht der deutschen Mitbestimmung zu schließen. Den Antrag hatten fünf Bundesländer mit rot-grüner Regierung eingebracht. Der erste Teil des Antrages will den Arbeitnehmerbegriff an die betriebliche Realität anpassen. Da die Zahl "arbeitnehmerähnlicher Personen" durch Digitalisierung und Netzwerkökonomie stetig wächst, sollen sie den gleichen Schutz wie normale Arbeitnehmer bekommen.
Der zweite Teil des Antrages bezieht sich auf die Flucht aus der Mitbestimmung. Die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) oder ausländische Rechtsformen werden immer häufiger als Mittel genutzt, um den Einfluss von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat zu begrenzen oder um die Mitbestimmung komplett zu umgehen. Die Hans-Böckler-Stiftung legt dazu regelmäßig Zahlen vor und bezeichnet den Zuwachs als "dramatisch" (siehe Bericht in den EBR-News 1/2015). Dieser Trend soll durch neue Gesetze gestoppt werden.
Bericht über den Antrag der fünf Bundesländer Der Beschluss des Bundesrates im Wortlaut Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes |
2. Wann kommt der Brexit-Tag für Europäische Betriebsräte? |
 |
|
Das Vereinigte Königreich ist noch zwei Jahre Vollmitglied der EU
Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU endet am 29. März 2019 automatisch. Die Austrittsverträge können von den verbleibenden 27 EU-Ländern nur rechtzeitig ratifiziert werden, wenn die Verhandlungen bis Oktober 2018 abgeschlossen sind. Das Europäische Parlament wird über die Inhalte der Verträge nicht nur konsultiert, sondern hat ein volles Veto-Recht. Die Abgeordneten gelten als deutlich kompromissloser als die EU-Bürokratie. Am 29. April 2017 beschließen die Staats- und Regierungschefs und am 22. Mai 2017 die Europäische Kommission Leitlinien für die Verhandlungen. Zunächst sollen Finanzfragen und der Status der EU-Bürger in Großbritannien geklärt werden. Vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland sind aber kaum ernsthafte Gespräche zu erwarten. Erst nach Klärung aller Trennungsfragen ist die EU bereit, über künftige Handelsbeziehungen zu reden. Theresa May hatte am 17. Januar 2017 erklärt, nicht nur die EU, sondern auch den Binnenmarkt zu verlassen. Andernfalls wäre eine Kontrolle über die Einwanderung und volle Souveränität über die Gesetzgebung nicht möglich.
Was geschieht, wenn die Verhandlungen scheitern oder länger dauern?
Um dies zu vermeiden, könnte die britische Regierung eine Verschiebung des EU-Austritts in Brüssel beantragen. Wahrscheinlicher ist aber, dass eine Übergangszeit ("transitional arrangement") vereinbart wird, in der ohne Zeitdruck weiterverhandelt werden kann. In dieser Übergangszeit ist das Land kein EU-Mitglied mehr, muss sich aber an die EU-Gesetze halten und in den EU-Haushalt einzahlen (wie Norwegen). Experten rechnen mit einer notwendigen Übergangszeit von zehn Jahren, das Europäische Parlament will höchstens drei Jahre akzeptieren, also bis März 2022.
Pressebericht über den "Rand der Klippe" Einschätzung zum weiteren Verhandlungsverlauf Der Rahmen einer möglichen Übergangsvereinbarung
Die Stunde der Wahrheit: irgendwann zwischen 2022 und 2029
Das Vereinigte Königreich hat wenig Alternativen, weiterhin Waren aus der EU zu importieren. Eine eigene Industrieproduktion hat das Mutterland der industriellen Revolution kaum noch. Stattdessen ist eine enorme Abhängigkeit vom Finanzsektor entstanden, der wegen des Brexit jedoch das Land verlässt. Das Ende des "transitional arrangement" ist der entscheidende Termin: ab diesem Tag wäre das Land nicht mehr Mitglied im Europäischen Binnenmarkt. Diesen Tag erlebte die Schweiz im Dezember 2016 (siehe Bericht in den EBR-News 4/2016). Auf dem Weg dorthin gibt es zahlreiche Hürden: die nächste Parlamentswahl findet spätestens 2020 statt, Schottland wird erneut über seine Unabhängigkeit entscheiden und die Wirtschaft jeden Tag neue Fakten schaffen. Vielleicht wird die EU ein Mitgliedsland verlieren, um dann vier neue hinzuzugewinnen, nämlich die vier Nachfolgestaaten des Vereinigten Königreichs.
Für Europäische Betriebsräte, SE-Betriebsräte und Besondere Verhandlungsgremien wird sich bis 29. März 2019 nichts ändern. Sollte es danach zu einem "transitional arrangement" kommen, wird sich während dieser Zeit ebenfalls nichts ändern, weil EU-Richtlinien weiterhin greifen. Aber selbst wenn zwischen 2022 und 2029 die Übergangsfrist endet, will die britische Regierung das EBR-Gesetz in Kraft lassen. Geltende Arbeitsgesetze sollen durch den Brexit nicht angetastet werden.
Weitere Informationen auf unserer Brexit-Sonderseite |
3. Sozialpolitik konservativer Regierungen |
 |
|
Wie stellen sich die Gewerkschaften in Polen zur Regierung?
Viele Beobachter in Westeuropa kritisieren diese polnische Regierung insbesondere für den Abbau der Demokratie (Verfassungsgericht, Medienreform etc.), sehen jedoch kaum die Sozialpolitik. Kernpunkte sind das Kindergeld (500 zł pro Kind und Monat, ca. 120 €), die Senkung des Steuersatzes für kleine Einkommen, Senkung des Rentenalters, sozialer Wohnungsbau, Anhebung des Mindestlohnes auf 2.000 zł brutto (ca. 475 €) seit Januar 2017. Da die Oppositionsparteien zu einem neoliberalen Kurs zurückkehren wollen, betrachten alle drei Gewerkschaftsbünde die Sozialpolitik der Regierung als alternativlos. Die katholische Solidarność steht ihr ideologisch nahe, will aber ihre Unabhängigkeit als Gewerkschaft bewahren. Die sozialdemokratische OPZZ und das linksliberale Forum ZZ haben in der Parteienlandschaft zur Zeit keinen politischen Partner. Seit Oktober 2015 beteiligen sich alle drei Gewerkschaftsbünde am Rat des Sozialen Dialogs (siehe Bericht in den EBR-News 4/2015).
Die wirtschaftliche Situation
Polen hat eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften Europas und ist als einziges EU-Land ohne Minuswachstum durch die Finanzmarktkrise gekommen. Die Arbeitslosigkeit liegt nur noch bei knapp 6%, die niedrigste Quote seit 25 Jahren. Bezogen auf die Kaufkraft hat Polen 2016 auf 69% des EU-Durchschnitts zugelegt und damit erstmals Ungarn und Griechenland überholt. Allerdings sind die Löhne mit durchschnittlich knapp 1.000 € pro Monat immer noch niedrig. Ausländische Investitionen steigen weiter an, auch der Brexit könnte zusätzliche Arbeitsplätze bringen. Von 38 Mio. Polen leben zwei Mio. im Ausland, die meisten davon (ein Drittel) im Vereinigten Königreich.
Tarifverhandlungen finden hauptsächlich auf betrieblicher Ebene statt, decken aber nur noch 11% aller abhängig Beschäftigten ab. 11% der polnischen Arbeitnehmer sind heute noch Gewerkschaftsmitglied. Dem Rückgang der Gewerkschaften steht der Aufbau von 3.300 Betriebsräten gegenüber, die aufgrund einer EU-Richtlinie eingeführt wurden (siehe Bericht in den EBR-News 3/2009). Bei den Europäischen Betriebsräten ist Polen stark vertreten: 57% aller EBR-Gremien haben polnische Delegierte. Allerdings gibt es mit dem Papierhersteller Arctic Paper nur ein einziges Unternehmen mit einem EBR basierend auf polnischem Recht (siehe Bericht in den EBR-News 3/2016).
Analyse des Verhältnisses zwischen Gewerkschaften und Regierung Bericht über Löhne und Sozialabgaben in Polen Jahresrückblick 2016 über die Arbeitsbeziehungen in Polen
Der Dachverband der finnischen Arbeitgeberverbände EK gab am 15. Februar 2017 bekannt, alle nationalen branchenübergreifenden Manteltarifverträge zu kündigen und nicht mehr neu zu verhandeln. In Zukunft sollen Tarifverträge nur noch für einzelne Branchen oder auf Unternehmensebene geschlossen werden. Am 13. März 2017 sagte der Präsident des EK, dass die Löhne immer noch 10-15% zu hoch wären, um international wettbewerbsfähig zu sein.
Die 22 gekündigten Tarifverträge behandeln Grundsatzfragen, die in anderen Ländern der Gesetzgeber regelt, z. B. die Rechte von betrieblichen Arbeitnehmervertretern (= Betriebsverfassung). Aber auch die betriebliche Weiterbildung oder die Abführung der Gewerkschaftsbeiträge über die Gehaltsabrechnung ("check-off") sind dort festgeschrieben. Wie in allen skandinavischen Ländern sind die Gewerkschaften stark: fast 70% aller Arbeitnehmer in Finnland sind Mitglied. Solche Vereinbarungen waren seit 1940 üblich, als die Arbeitgeberverbände erstmals Gewerkschaften landesweit als Tarifpartner anerkannten.
Bericht über die Kündigung der Tarifverträge
Pilotprojekt zum Grundeinkommen, trotz Klima des Sozialabbaus
In Finnland regiert seit Mai 2015 eine konservative Koalition mit Beteiligung einer rechtspopulistischen Partei, die mit harten Sozialkürzungen die hohe Arbeitslosigkeit (9%) bekämpfen will. Im September 2015 riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik auf (siehe Bericht in den EBR-News 3/2015). Im Juni 2016 schlossen sie sich dann aber dem "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit" der Regierung an. Seine Eckpunkte: Arbeitnehmer arbeiten pro Jahr drei Tage mehr – bei gleichem Gehalt. Die Löhne werden ein Jahr lang eingefroren, Sozialbeiträge der Arbeitnehmer leicht erhöht und die Arbeitgeberbeiträge gesenkt. Seit Januar 2017 läuft ein Pilotprojekt mit 2.000 zufällig ausgesuchten Langzeit-Arbeitslosen. Sie erhalten zwei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen von 560 € monatlich.
Bericht über den Wettbewerbspakt Analyse des Wettbewerbspakts aus Arbeitnehmersicht Bericht über das Pilotprojekt zum Grundeinkommen Ausführliche Reportage zum Pilotprojekt |
4. Kritische Momente für Betriebsräte |
 |
|
Europäischer Betriebsrat rückt in weite Ferne
Die Stellungnahme des damaligen EBR-Vorsitzenden
Bei Hewlett-Packard endete die gesetzliche Frist, um eine vollwertige EBR-Vereinbarung basierend auf britischem Recht zu schließen, im Februar 2017. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Aufspaltung des Konzerns konnten die Verhandlungen jedoch nicht bis zu Ende geführt werden. Im November 2015 wurden Hardware für Rechenzentren und die Dienstleistungssparte mit weltweit 250.000 Beschäftigten in das neue Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) ausgegliedert. Der verbleibende PC- und Druckerbereich firmiert als HP Inc. und hat weltweit nur 50.000 Arbeitnehmer, in Europa vorwiegend in Vertrieb und Service. Gleichzeitig fand ein erheblicher Personalabbau statt. Der Vorsitzende des BVG aus den Niederlanden verließ das Unternehmen und zahlreiche Delegierte, die zur neuen Firma HPE wechselten, verloren damit automatisch ihr Mandat im BVG.
Für HPE hätte ein Antrag zur Gründung eines Europäischen Betriebsrates gestellt werden können, die Frist von drei Jahren beginnt dann aber bei Null. Doch die Ereignisse überschlugen sich. Im Mai 2016 kündigte die Konzernleitung an, dass die neugegründete HPE ebenfalls zerlegt wird und nur noch das Geschäft mit der Server-Hardware behält. Die IT-Dienstleistungssparte wird an das US-Unternehmen Computer Sciences Corporation (CSC) abgegeben, womit einer der weltweit größten IT-Dienstleister entsteht. CSC hat seit 2000 einen Europäischen Betriebsrat nach deutschem Recht. Ein Teil der Belegschaft von HPE wurde in die Datagroup ausgegliedert, die seit November 2016 als Europäische Gesellschaft (SE) firmiert (siehe Bericht in den EBR-News 4/2016). Ein weiterer Teil der Belegschaft wurde an den US-Personaldienstleister Manpower überführt, wo es 2014 im Zuge der Gründung eines Europäischen Betriebsrates einen Rechtssteit gab (siehe Bericht in den EBR-News 2/2014).
Europäische Betriebsräte sollen nach Irland auswandern
In Vorwegnahme des Brexit haben sowohl HP Inc. als auch Hewlett Packard Enterprise (HPE) erklärt, dass sie ihre Europäischen Betriebsräte nicht mehr nach britischem Recht gründen wollen. Vielmehr sollen beide in Irland angesiedelt werden.
Bericht über die Umstrukturierungen (siehe Seite 6) Deutsch-französische Kooperation im EBR notwendig
Der französische Automobilhersteller PSA (Peugeot Citroën) will die europäischen Standorte von General Motors mit den Marken Opel und Vauxhall übernehmen. Dies wurde am 14. Februar 2017 bekannt. Bereits am 20. Februar 2017 traf die Konzernleitung von PSA den Europäischen Betriebsrat von General Motors, um mit ihm mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigung zu diskutieren. Die Arbeitnehmer haben von Opel die Zusage, dass es vor Ende 2018 keine Entlassungen geben wird. Für einige Werke gibt es eine Garantie bis 2020.
Auf mündliche Zusagen von PSA wollen sich die Betriebsräte jedoch nicht verlassen. Der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrates forderte am 24. März 2017 schriftliche, "gerichtsfeste" Garantien und drohte indirekt mit Streiks. Die Beschäftigungszusagen sollen in den Kaufverträgen festgeschrieben werden. Experten rechnen als Folge der Fusion mit einem Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen. Seit 1999 hat General Motors Europe keinen Gewinn mehr erzielt. Der französische Staat hält 12,7% der Anteile an PSA und signalisierte bereits, einen Kahlschlag bei Opel nicht zu unterstützen. Seit 2012 gibt es bereits eine Kooperation zwischen den beiden Unternehmen (siehe Bericht in den EBR-News 1/2012). PSA wird mit der Fusion zum zweitgrößten Automobilhersteller in Europa nach Volkswagen.
Pressebericht über die Forderungen des Betriebsrates
Brexit bedroht englische Standorte
Vauxhall hat in zwei englischen Werken 4.500 Beschäftigte, deren Zukunft durch den Brexit in Gefahr ist. Anfang 2018 muss die Konzernleitung entscheiden, wo künftig der neue Astra gebaut wird. Es gibt Befürchtungen, das Werk in Ellesmere Port bei Liverpool könnte die Astra-Produktion verlieren.
Bericht über die Situation bei Vauxhall Bericht über die politische Diskussion in England
Fusion der beiden Europäischen Betriebsräte?
Beide Unternehmen haben seit 1996 einen Europäischen Betriebsrat auf "freiwilliger" Basis, General Motors Europe nach deutschem Recht. Der Vorsitz bei PSA liegt nach französischem Modus beim Vorstandsvorsitzenden des Konzerns. Wenn die Fusion Ende 2017 abgeschlossen ist, müssten beide Gremien zusammengelegt werden. Artikel 13 der EU-Richtlinie schreibt die Bildung eines Besonderen Verhandlungsgremiums vor. Die beiden Europäischen Betriebsräte könnten parallel voneinander bis zu drei Jahre weiterarbeiten. Es wäre auf freiwilliger Basis sogar möglich, beide dauerhaft beizubehalten.
Im März 2016 hatte der französische Automobilhersteller Renault seine EBR-Vereinbarung umfassend erneuert und sich komplett der EU-Gesetzgebung unterworfen. Um dies juristisch abzusichern und den Status einer "freiwilligen" Vereinbarung zu beenden, wurde ein Besonderes Verhandlungsgremium gebildet (siehe Bericht in den EBR-News 2/2016). Bei PSA war es im Vorfeld zu der Schließung des Automobilwerkes Aulnay bei Paris zu einem Rechtsstreit über das Konsultationsverfahren gekommen. Ein Gericht in Paris bestätigte im Januar 2013 einen Unterlassungsanspruch der Betriebsräte (siehe Bericht in den EBR-News 1/2013). Zum PSA-Konzern gehört auch der Automobilzulieferer Faurecia, der seit 2003 einen eigenen EBR nach französischem Recht hat. |
5. Aktuelle Gerichtsverfahren |
 |
|
US-Unternehmen muss Aktienoptionen offenlegen
Im Juni 2016 hatte der Europäische Betriebsrat von Mayr-Melnhof aufgrund Verletzung seiner Unterrichtungs- und Anhörungsrechte eine Klage eingereicht. Die zentrale Leitung des Kartonherstellers steht seit Jahren in der Kritik, weil sie ihre Arbeitnehmervertreter nicht korrekt einbezieht (siehe Bericht in den EBR-News 3/2016). In Österreich ist es die allererste gerichtliche Auseinandersetzung zu diesem Thema, die es je gab. Es ist auch der einzige laufende EBR-Rechtsstreit in ganz Europa. Ähnliche Verfahren in zwei anderen Unternehmen konnten 2016 außergerichtlich beigelegt werden (siehe Bericht in den EBR-News 2/2016).
Am 1. Februar 2017 brachte eine Güteverhandlung vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien keinerlei Annäherung. Zu der vom Gericht vorgeschlagenen Mediation ist es nicht gekommen. Stattdessen fand am 15. März 2017 eine Sondierungsrunde zwischen der zentralen Leitung und dem EBR statt, um die strittigen Fragen zu klären. Da es hier ebenfalls keine Lösung gab, wird das Gericht nun in Kürze sein Urteil verkünden. Am Ende könnte dieser Rechtsstreit bis zum Europäischen Gerichtshof führen. Da in allen bisherigen Fällen jedoch eine außergerichtliche Einigung erzielt wurde, müssen sämtliche 1.121 Europäischen Betriebsräte nach wie vor auf die erste Grundsatzentscheidung aus Luxemburg warten. Der bisherige Höhepunkt gerichtlicher Auseinandersetzungen zum EBR-Recht war 2012 erreicht, als in fünf Ländern gleichzeitig Verfahren liefen (siehe Bericht in den EBR-News 4/2012). Gewerkschaften klagen gegen SAP
Anders als bei einer deutschen Aktiengesellschaft wird der Aufsichtsrat einer SE nicht nach Gesetz, sondern basierend auf der SE-Beteiligungsvereinbarung zusammengesetzt. Ende Januar 2017 fand vor dem Arbeitsgericht Mannheim ein Gütetermin statt, der kein Ergebnis brachte. Auch über die Größe des Aufsichtsrates beim Modeversender Zalando SE gibt es eine gerichtliche Auseinandersetzung. Im Juni 2016 urteilte das Arbeitsgericht Berlin in erster Instanz (siehe Bericht in den EBR-News 3/2016) und im Februar 2017 das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in zweiter Instanz.
Pressebericht über die Klage bei SAP Pressemitteilung zum Zalando-Urteil |
6. Neugründung von Europäischen Betriebsräten |
 |
|
Möbelhersteller hat künftig zwei Europäische Betriebsräte
Der Vorsitz in den jährlichen Plenarsitzungen bei Inter IKEA liegt beim Arbeitgeber, jedes Jahr findet eine zweite Sitzung ohne den Arbeitgeber statt. Zusätzlich zu Sitzungszeiten hat jedes EBR-Mitglied Anspruch auf zehn Tage Freistellung pro Jahr. Die laufenden Geschäfte führt ein engerer Ausschuss aus fünf Mitgliedern, die jeweils über 36 Tage Freistellungszeit pro Jahr verfügen. Der Vorsitzende des engeren Ausschusses ist durchschnittlich zwei Tage pro Woche für EBR-Aufgaben freigestellt. Das größte Land im EBR ist Polen, wo sich wichtige Produktionsstätten von IKEA befinden. Französische Handelskette gründet EBR
Die 18 Mitglieder sind aus Frankreich (neun Sitze), Belgien, Spanien, Portugal und den Niederlanden. Die Schweiz und Monaco haben je ein Gastmandat. Der Vorsitz in den jährlichen Plenarsitzungen in Paris liegt beim Arbeitgeber. Von den fünf Mitgliedern im Lenkungsausschuss kommen höchstens zwei aus Frankreich. Alle EBR-Mitglieder haben Anspruch auf 60 Stunden Freistellung pro Jahr, die Mitglieder im Lenkungsausschuss 120 und der Sekretär 180 Stunden. Sitzungszeiten werden hierauf nicht angerechnet. Für jedes einzelne Restrukturierungsprojekt kommen zwanzig Stunden hinzu. Das Budget für die laufende Beratung beträgt 20.000 € jährlich, für Restrukturierungsprojekte wird ad hoc ein Zusatzbudget festgelegt. Pro Amtszeit erhält der EBR zwei Tage betriebswirtschaftliche Schulung sowie Sprachkurse. Das Budget für Arbeitsmittel und interne Übersetzungen liegt bei 8.000 € pro Jahr.
Die EBR-Vereinbarung im Wortlaut |
7. Update von EBR-Vereinbarungen |
 |
|
Italienischer Zementhersteller erneuert EBR-Vereinbarung
Am 29. November 2016 wurde am Sitz von Buzzi Unicem in Casale Monferrato, der "Hauptstadt des Zement" im Piemont, die EBR-Vereinbarung erneuert. Der Europäische Betriebsrat besteht seit 2008, nachdem der deutsche Dyckerhoff-Konzern übernommen wurde. Dort gab es zuvor schon ab 1996 einen EBR nach deutschem Recht. Die heutige EBR-Vereinbarung von Buzzi Unicem war 2012 die erste, die auf Grundlage des neuen italienischen EBR-Gesetzes unterzeichnet wurde (siehe Bericht in den EBR-News 4/2012). Da sie zeitlich befristet war, musste sie jetzt verlängert werden.
Künftig hat der EBR 15 Mitglieder, davon sechs aus Italien und vier aus Deutschland. Er vertritt 4.700 Arbeitnehmer in der EU, größtes Land ist Deutschland mit ca. 1.800. Hinzu kommen die Niederlande, Luxemburg, Polen, Tschechien und die Slowakei. Er tagt einmal jährlich sowie bei außerordentlichen Umständen. Im Lenkungsausschuss sitzen drei Delegierte aus Italien und zwei aus Deutschland, sie tagen halbjährlich. Ständige Gäste sind Gewerkschaftssekretäre der drei italienischen Organisationen sowie ein von der Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter (EFBH) in Brüssel benannter Koordinator. Weiterhin kann der EBR einen Berater beauftragen, dessen Honorar vom Unternehmen bezahlt wird. Jedes Jahr sind zwei Schulungstage vorgesehen. Hersteller von Bodenbelägen verbessert EBR-Vereinbarung
Am 1. Dezember 2016 wurde in Paris eine neue Vereinbarung über das Europaforum von Tarkett unterzeichnet. Das Forum war bereits 1996 nach deutschem Recht gegründet worden. Als Folge einer Fusionswelle befindet sich der Sitz des Konzerns heute in der Pariser Bürovorstadt La Défence. Der Vorsitz im Europaforum liegt traditionell bei einem gewählten Arbeitnehmervertreter, was in Frankreich nicht üblich ist. Tarkett hat 12.500 Beschäftigte in 100 Ländern der Welt und 34 Produktionsstätten.
Das Europaforum hat 18 Mitglieder aus acht Ländern. Sie treffen sich einmal pro Jahr, abwechselnd in der Zentrale in Paris und in einer Niederlassung. Im Präsidium sind alle acht Länder mit je einem Sitz vertreten. Sie treffen sich dreimal pro Jahr mit der zentralen Leitung. Das Europaforum hat Anspruch auf zwei gemeinsame Schulungstage pro Jahr, zusätzlich kann jeder Delegierte drei Schulungstage pro Amtszeit individuell in Anspruch nehmen. Der Text ist knapp und präzise formuliert und verzichtet auf starke Reglementierungen, wie sie in französischen EBR-Vereinbarungen sonst üblich sind. Aktualisierte Vereinbarung im französischen Baukonzern
Der EBR hat 22 Mitglieder aus neun Ländern, davon neun aus Frankreich und je drei aus Deutschland und Belgien. Erstmals erstreckt sich die Vereinbarung auch auf die Schweiz. Der Lenkungsausschuss besteht aus dem Sekretär, dem Kassenwart und drei weiteren Mitgliedern, die aus mindestens vier Ländern kommen. Die quartalsweisen Sitzungen werden probeweise als Videokonferenzen organisiert. Plenarsitzungen finden zweimal pro Jahr unter Vorsitz des Arbeitgebers statt. Sondersitzungen sind in außerordentlichen Umständen vorgesehen, wenn zwei Drittel der EBR-Mitglieder dies beantragt.
Wie in Frankreich üblich, ist die Freistellungszeit genau definiert. Jeder Delegierte erhält fünf Tage, die Mitglieder des Lenkungsausschusses zehn Tage pro Jahr zusätzlich zu den Zeiten für Sitzungen. Das Jahresbudget des EBR beträgt 60.000 € für seine normale Arbeit und 30.000 € für Schulungen, hinzu kommen die Kosten für die regelmäßige Beratung durch einen Wirtschaftsprüfer. Jedes Jahr werden im zeitlichen Zusammenhang mit einer Plenarsitzung zwei Schulungstage organisiert, zu denen auch die Ersatzmitglieder eingeladen werden. Da der Konzern permanent seine Struktur ändert, enthält die Vereinbarung einen Anhang mit Muster-Datenblättern, die für den Fall von Akquisitionen und Verkäufen die an den EBR zu liefernden Informationen auflisten. |
8. Neue SE-Umwandlungen |
 |
|
Brexit treibt Großbank nach Frankfurt und in die Rechtsform der SE
Im Aufsichtsrat haben die Arbeitnehmer zwei von sechs Sitzen. Mit 780 Arbeitnehmern in Deutschland war die Drittelbeteiligung hier maßgebend. Der Aufsichtsrat soll aber bald auf neun Sitze vergrößert werden, davon drei Arbeitnehmervertreter. Ein Sitz entfällt auf Deutschland, ein weiterer auf Italien, der künftige dritte Sitz auf Luxemburg. Der SE-Betriebsrat startet mit zwölf Mitgliedern, darunter vier aus Deutschland. Der geschäftsführende Ausschuss hat fünf Mitglieder und wird auf acht vergrößert, wenn der SE-Betriebsrat anwächst, z. B. durch die Brexit-Verlagerungen. Es sind zwei Plenarsitzungen pro Jahr mit der zentralen Leitung vorgesehen.
Problematische Klauseln in der SE-Vereinbarung
Das Konsultationsverfahren beinhaltet sehr enge Fristen. Der SE-Betriebsrat kann eine Stellungnahme nur innerhalb von 14 Tagen abgeben. Die für das SE-Recht typische zweite Runde der Anhörung muss innerhalb von sieben Tagen beantragt werden, falls die Stellungnahme von der zentralen Leitung nicht berücksichtigt wurde. Dann findet innerhalb von 14 Tagen eine weitere Sondersitzung statt, um eine Einigung zu erzielen. Kommt keine Einigung zustande, endet das Konsultationsverfahren spätestens 14 Tage danach. In besonders dringenden Fällen ist ein Schnellverfahren ("Fast Track Procedure") mit verkürzten Fristen und einer Videokonferenz vorgesehen.
Der SE-Betriebsrat kann bei einer Verletzung seiner Beteiligungsrechte ausdrücklich nicht vor Gericht ziehen, um eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Eine ähnliche Formulierung findet sich auch in der SE-Vereinbarung des Modeversenders Zalando (siehe Bericht in den EBR-News 2/2014) und dürfte vermutlich gegen die SE-Richtlinie verstoßen. Es gibt keine rechtliche Möglichkeit, diese Formulierung außer Kraft zu setzen, denn die Vereinbarung enthält eine "Ewigkeitsklausel". Wird sie gekündigt und scheitern Neuverhandlungen, gilt sie unverändert weiter. Die Arbeitnehmervertreter können niemals auf die Auffangregelung der SE-Richtlinie zurückgreifen. Sollte es künftig Konflikte geben, ist ein Weg wie in der britischen Großbank HSBC ausgeschlossen (siehe Bericht in den EBR-News 1/2014).
Die Muttergesellschaft in Zürich hat seit 2002 einen Europäischen Betriebsrat ("European Employee Forum") nach britischem Recht, der parallel zum neuen SE-Betriebsrat weiterarbeitet. Dort sind als Nicht-EU-Länder neben der Schweiz auch Russland, die Türkei und Monaco vertreten.
Pressebericht über die neue Gesellschaft Pumpenhersteller will keine Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Am 10. August 2016 wurde die SE-Beteiligungsvereinbarung unterzeichnet, es ist eine der kürzesten, die in der Geschichte dieser Rechtsform jemals geschlossen wurde. Der Text verweist lediglich auf die Auffangregelungen des deutschen SE-Gesetzes. Der neue SE-Betriebsrat hat 22 Mitglieder, darunter sechs aus Deutschland, und vertritt 1.230 Arbeitnehmer in 16 Ländern, die meisten mit nur kleinen Vertriebsniederlassungen. Interessant ist die Brexit-Klausel: Länder, die am 1. Juni 2016 Mitglied der EU waren, bleiben dauerhaft im SE-Betriebsrat vertreten. Lebensmittel-Versender bildet Europaforum
Am 7. November 2016 wurde eine SE-Beteiligungsvereinbarung für HelloFresh unterzeichnet. Seit dem 14. Dezember 2016 firmiert das Unternehmen aus Berlin als SE. HelloFresh ist weltweit der größte Lieferdienst für Lebensmittel nach vorbereitetem Rezept im Abonnement, den "Kochboxen". Das 2011 gegründete Startup hat etwa 800 Arbeitnehmer in neun Ländern und wächst sehr stark. Das Kapital stammt von den gleichen Finanzinvestoren, die auch schon den Modeversender Zalando gegründet hatten.
Das Besondere Verhandlungsgremium hatte zwölf Mitglieder, darunter acht aus den Niederlanden, drei aus Deutschland und eines aus dem Vereinigten Königreich. Dem neuen Europaforum, so der Name des SE-Betriebsrates, gehört pro Land nur ein Mitglied an, derzeit drei. Sie tagen einmal jährlich und werden von der Belegschaft ihres Landes direkt gewählt. Ein geschäftsführender Ausschuss wird erst gebildet, wenn das Europaforum mehr als fünf Mitglieder hat. Im Aufsichtsrat ist die Belegschaft nicht vertreten. In der Branche der Startup-Versandhändler ist die Rechtsform SE sehr beliebt, zuletzt hatte sich windeln.de in eine SE umgewandelt (siehe Bericht in den EBR-News 3/2016).
Hintergrundbericht zur Rechtsform der SE Aktuelles Datenblatt der Hans-Böckler-Stiftung |
9. Der Blick über Europa hinaus |
 |
|
Norwegischer Baukonzern erneuert Rahmenabkommen
Bericht von der Unterzeichnung Belgischer Chemiekonzern mit beispielhaften Regelungen
Am 1. April 2017 startet ein Sozialprogramm ("Solvay Cares") mit verbessertem Mutterschaftsurlaub und einer Zusatzkrankenversorgung, das am 22. Februar 2017 vom Weltbetriebsrat vereinbart wurde. Das Familienunternehmen beteiligt seine 31.000 Beschäftigten in 53 Ländern auch am Gewinn (siehe Bericht in den EBR-News 2/2016).
Bericht von der Unterzeichnung des Rahmenabkommens Das Rahmenabkommen im Wortlaut Bericht über das weltweite Sozialprogramm Französischer Automobilkonzern stärkt Weltbetriebsrat
Das sehr weitreichende und umfassende Abkommen beinhaltet neben den Kernarbeitsnormen auch Grundsätze des Sozialen Dialogs, der Personal- und Kompetenzentwicklung, Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Gleichbehandlung und der digitalen Transformation. Die Grundsätze gelten ausdrücklich auch für Zulieferer, Subunternehmer, industrielle Partner und Vertriebsnetze. Neben dem Weltbetriebsrat, der das Abkommen überwachen wird, gibt es zwei Gremien in Europa: seit 1996 den Europäischen Betriebsrat und seit 2008 einen gemeinsamen Strategieausschuss, in dem sich das Management des Konzerns einmal jährlich mit den Gewerkschaften der wichtigsten Länder trifft, um vertrauliche Diskussionen in einem frühen Stadium zu führen (siehe Bericht in den EBR-News 3/2008).
Bericht von der Unterzeichnung Das Rahmenabkommen im Wortlaut |
10. Interessante Webseiten |
 |
|
Baukasten für EBR-Mitglieder
Verantwortliches Investment weltweit
Mehr Rechtssicherheit für Leiharbeiter in Belgien
Die Webseite für belgische Leiharbeiter Informationsblatt zu den neuen Rechten Kampagne gegen negative Auswirkungen des Brexit
Die Webseite der Brexit-Gegner |
11. Neue Publikationen |
 |
|
Seit der Krise des europäischen Währungssystems haben die Institutionen der EU in bislang unbekannter Weise direkt Einfluss auf die Entwicklung von Löhnen und Tarifvertragssystemen genommen. Im November 2016 ist dieser Sammelband erschienen, der die Reichweite und Auswirkungen dieses als "Economic Governance" bezeichneten Interventionismus in verschiedenen europäischen Regionen untersucht. Es handelt sich um Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das von gewerkschaftsnahen Instituten aus 13 Ländern mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission durchgeführt wurde. Die Schlußfolgerung der Autoren: Europa braucht eine koordinierte Lohnpolitik, die überall angemessene Mindestlöhne sicherstellt und auch die Tarifvertragssysteme stärkt.
Weitere Informationen mit Leseprobe Die ausführlichen Forschungsergebnisse Leitfaden zur Unterrichtung und Anhörung im EBR
Informationen über das Projekt
Im Dezember 2016 ist dieses Handbuch erschienen, das in drei Kapiteln verschiedene Aspekte der Arbeit Europäischer Betriebsräte beleuchtet. Am Anfang wird der gesetzliche Rahmen behandelt und einige Merkpunkte für die Aushandlung von EBR-Vereinbarungen benannt, darunter der Begriff der länderübergreifenden Zuständigkeit des EBR, die Abstimmung zwischen den nationalen und Europäischen Betriebsräten und Fragen der Vertraulichkeit. Im zweiten Kapitel ist ein Vergleich der Arbeitsbeziehungen der einzelnen europäischen Länder zu finden und das dritte Kapitel beinhaltet Übungen zur Verbesserung der internen Zusammenarbeit im EBR. Das Handbuch wurde in einem zweijährigen Projekt von einer französischen Beratungsfirma mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission erarbeitet.
Unternehmensverantwortung in der Lieferkette
Download der Studie zum Bangladesch-Abkommen Webseite zum Bangladesch-Abkommen Bericht über die Verabschiedung der OECD-Richtlinien Die neuen OECD-Richtlinien im Wortlaut |
12. Die EWC Academy: Beispiele aus unserer Arbeit |
 |
|
Fachtagung mit 53 Teilnehmern aus zehn Ländern
Lenkungsausschuss will EBR-Praxis verbessern
Zusammenlegung von zwei Europäischen Betriebsräten
Bisher gibt es in beiden Unternehmen einen Europäischen Betriebsrat. Bei TRW Automotive wurde er 1997 gegründet und basiert auf britischem Recht (siehe Bericht in den EBR-News 3/2016). Grundlage der Zusammenlegung beider Gremien wird die EBR-Vereinbarung von ZF Friedrichshafen sein, die 2000 nach deutschem Recht geschlossen wurde. Sie soll im Zuge der Fusion aktualisiert werden, was bereits 2013 geplant war (siehe Bericht in den EBR-News 1/2013). Die Bildung eines Besonderen Verhandlungsgremiums nach Artikel 13 der EU-Richtlinie ist nicht vorgesehen. |
13. Aktuelle Seminartermine |
 |
|
Die EWC Academy und ihre Vorläuferorganisation führt seit Januar 2009 Tagungen und Seminare für Mitglieder von Europäischen Betriebsräten, SE-Betriebsräten und Besonderen Verhandlungsgremien durch. Bisher haben daran 726 Arbeitnehmervertreter aus 260 Unternehmen teilgenommen, viele von ihnen auch mehrfach. Das entspricht etwa 21% aller transnationalen Betriebsratsgremien in Europa. Hinzu kommen zahlreiche Inhouse-Veranstaltungen und Gastvorträge bei anderen Veranstaltern.
Überblick über die bevorstehenden Seminartermine EBR-Seminare auf Schloss Montabaur (auch für SE-Betriebsräte geeignet)
Bericht von diesem Seminar im April 2012 Sprachkurse: Business-Englisch für Betriebsräte
Weitere Informationen über unsere Sprachkurse
US-Tagung für Betriebsratsmitglieder
Shared Service Center in Mittel- und Osteuropa
Inhouse-Veranstaltungen
|
14. Impressum |
 |
|
Die EBR-News werden herausgegeben von:
|
 |
 Das Exekutivkomitee des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) tagte am 15. und 16. März 2017 in Valletta, der Hauptstadt von Malta. Es ist das höchste Organ zwischen den alle vier Jahre stattfindenden Kongressen und trifft Grundsatzentscheidungen. Malta hat im Moment die Ratspräsidentschaft der EU inne. Die Delegierten befassten sich mit der Richtlinie zum Europäischen Betriebsrat und verabschiedeten ein Positionspapier. Die Überarbeitung der Richtlinie ist seit Juni 2016 überfällig, obwohl die Europäische Kommission im April 2015 mit den Vorarbeiten begonnen hatte (siehe
Das Exekutivkomitee des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) tagte am 15. und 16. März 2017 in Valletta, der Hauptstadt von Malta. Es ist das höchste Organ zwischen den alle vier Jahre stattfindenden Kongressen und trifft Grundsatzentscheidungen. Malta hat im Moment die Ratspräsidentschaft der EU inne. Die Delegierten befassten sich mit der Richtlinie zum Europäischen Betriebsrat und verabschiedeten ein Positionspapier. Die Überarbeitung der Richtlinie ist seit Juni 2016 überfällig, obwohl die Europäische Kommission im April 2015 mit den Vorarbeiten begonnen hatte (siehe 
 Am 29. März 2017 stellte die britische Premierministerin Theresa May den offiziellen Antrag auf Austritt aus der EU. Zuvor hatte es einen Rechtsstreit gegeben, ob dies mit oder ohne Beschluss des Parlaments möglich ist. Zeitgleich forderte Schottland ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit. Auch Nordirland und Wales führen Diskussionen über den Verbleib im Vereinigten Königreich. Für England gibt es Vorschläge zur Bildung von Regionalräten.
Am 29. März 2017 stellte die britische Premierministerin Theresa May den offiziellen Antrag auf Austritt aus der EU. Zuvor hatte es einen Rechtsstreit gegeben, ob dies mit oder ohne Beschluss des Parlaments möglich ist. Zeitgleich forderte Schottland ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit. Auch Nordirland und Wales führen Diskussionen über den Verbleib im Vereinigten Königreich. Für England gibt es Vorschläge zur Bildung von Regionalräten. Sollte am 29. März 2019 kein Abkommen ratifiziert sein, z. B. weil eines der beteiligten Parlamente den Vertrag ablehnt, würde das Vereinigte Königreich vom "Rand der Klippe" stürzen. Regeln der EU und des Binnenmarktes würden um Mitternacht ersatzlos wegfallen. Michel Barnier, oberster Brexit-Verhandlungsführer der EU, wies am 22. März 2017 auf die negativen Konsequenzen hin: Starke Störungen des Flugverkehrs und lange LKW-Schlangen im Kanalhafen von Dover, das Auseinanderreißen von Lieferketten bis hin zum Stopp der Lieferung von Nuklearmaterial auf die Insel.
Sollte am 29. März 2019 kein Abkommen ratifiziert sein, z. B. weil eines der beteiligten Parlamente den Vertrag ablehnt, würde das Vereinigte Königreich vom "Rand der Klippe" stürzen. Regeln der EU und des Binnenmarktes würden um Mitternacht ersatzlos wegfallen. Michel Barnier, oberster Brexit-Verhandlungsführer der EU, wies am 22. März 2017 auf die negativen Konsequenzen hin: Starke Störungen des Flugverkehrs und lange LKW-Schlangen im Kanalhafen von Dover, das Auseinanderreißen von Lieferketten bis hin zum Stopp der Lieferung von Nuklearmaterial auf die Insel. Im September 2013 demonstrierten mehr als 100.000 Menschen gegen die damalige liberal-konservative Regierung von Premierminister Donald Tusk (Foto). Aufgerufen hatten die drei großen Gewerkschaftsverbände gemeinsam. Ihrer Auffassung nach war die damalige Regierung für die "Starken und Reichen", für Arbeitgeber und das "ausländische Kapital" günstig, kümmerte sich aber fast nicht um die Interessen der "kleinen Leute". Hierin liegt eine der Ursachen, warum die nationalkonservative Partei PiS seit November 2015 die Regierung stellt.
Im September 2013 demonstrierten mehr als 100.000 Menschen gegen die damalige liberal-konservative Regierung von Premierminister Donald Tusk (Foto). Aufgerufen hatten die drei großen Gewerkschaftsverbände gemeinsam. Ihrer Auffassung nach war die damalige Regierung für die "Starken und Reichen", für Arbeitgeber und das "ausländische Kapital" günstig, kümmerte sich aber fast nicht um die Interessen der "kleinen Leute". Hierin liegt eine der Ursachen, warum die nationalkonservative Partei PiS seit November 2015 die Regierung stellt. Sämtliche Manteltarifverträge in Finnland gekündigt
Sämtliche Manteltarifverträge in Finnland gekündigt Seit Januar 2014 gibt es im US-Konzern Hewlett-Packard keinen Europäischen Betriebsrat mehr. Der 1996 errichtete EBR hatte die "freiwillige" Vereinbarung gekündigt und das Unternehmen vor dem Arbeitsgericht Brüssel verklagt. Auslöser waren eine mangelhafte Unterrichtung über bevorstehende Massenentlassungen verbunden mit der regelmäßigen Beschränkung seiner Arbeitsmöglichkeiten (siehe
Seit Januar 2014 gibt es im US-Konzern Hewlett-Packard keinen Europäischen Betriebsrat mehr. Der 1996 errichtete EBR hatte die "freiwillige" Vereinbarung gekündigt und das Unternehmen vor dem Arbeitsgericht Brüssel verklagt. Auslöser waren eine mangelhafte Unterrichtung über bevorstehende Massenentlassungen verbunden mit der regelmäßigen Beschränkung seiner Arbeitsmöglichkeiten (siehe 
 Am 17. Januar 2017 entschied das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg über eine Klage des Betriebsrats von Dow Chemical im Werk Rheinmünster bei Karlsruhe. Das Management hatte ihm Auskünfte über die Gewährung von Aktienoptionen verweigert, die die US-Zentrale in Eigenregie festlegt und verteilt. Dem Betriebsrat stehen laut Urteil zwar keine Mitbestimmungsrechte über solche Anreizsysteme zu. Die deutsche Konzerntochter muss ihm aber mitteilen, welche Arbeitnehmer in welchem Umfang Wertpapiere erhalten. Nur so kann der Betriebsrat seine gesetzliche Rolle wahrnehmen und die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer überprüfen.
Am 17. Januar 2017 entschied das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg über eine Klage des Betriebsrats von Dow Chemical im Werk Rheinmünster bei Karlsruhe. Das Management hatte ihm Auskünfte über die Gewährung von Aktienoptionen verweigert, die die US-Zentrale in Eigenregie festlegt und verteilt. Dem Betriebsrat stehen laut Urteil zwar keine Mitbestimmungsrechte über solche Anreizsysteme zu. Die deutsche Konzerntochter muss ihm aber mitteilen, welche Arbeitnehmer in welchem Umfang Wertpapiere erhalten. Nur so kann der Betriebsrat seine gesetzliche Rolle wahrnehmen und die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer überprüfen. Gerichtsverfahren in Wien immer noch in der Schwebe
Gerichtsverfahren in Wien immer noch in der Schwebe Die Gewerkschaften IG Metall und ver.di wollen mit einer Klage verhindern, dass SAP ab 2019 seinen Aufsichtsrat verkleinert. Im Rahmen der Umwandlung des Softwarekonzerns in eine Europäische Gesellschaft (SE) wurde im März 2014 eine SE-Beteiligungsvereinbarung geschlossen, die einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat mit 18 Mitglieden vorsieht (siehe
Die Gewerkschaften IG Metall und ver.di wollen mit einer Klage verhindern, dass SAP ab 2019 seinen Aufsichtsrat verkleinert. Im Rahmen der Umwandlung des Softwarekonzerns in eine Europäische Gesellschaft (SE) wurde im März 2014 eine SE-Beteiligungsvereinbarung geschlossen, die einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat mit 18 Mitglieden vorsieht (siehe  Im September 2016 wurde die Fertigung und Logistik der IKEA Group in das Unternehmen Inter IKEA ausgegliedert. Die betroffenen 26.000 Beschäftigten bekommen jetzt ihren eigenen EBR. Am 29. November 2016 wurde die Vereinbarung in Delft (Niederlande) unterzeichnet. Sie orientiert sich weitgehend am Text der IKEA Group, wo es bereits seit 1999 einen EBR gibt. Dieser vertritt die 132.000 Beschäftigten in den Verkaufsfilialen, im Kundendienst und in den Call Centern. IKEA hat seinen Firmensitz aus steuerlichen Erwägungen in den Niederlanden (siehe
Im September 2016 wurde die Fertigung und Logistik der IKEA Group in das Unternehmen Inter IKEA ausgegliedert. Die betroffenen 26.000 Beschäftigten bekommen jetzt ihren eigenen EBR. Am 29. November 2016 wurde die Vereinbarung in Delft (Niederlande) unterzeichnet. Sie orientiert sich weitgehend am Text der IKEA Group, wo es bereits seit 1999 einen EBR gibt. Dieser vertritt die 132.000 Beschäftigten in den Verkaufsfilialen, im Kundendienst und in den Call Centern. IKEA hat seinen Firmensitz aus steuerlichen Erwägungen in den Niederlanden (siehe  Am 6. Dezember 2016 wurde am Sitz der Handelskette Fnac im Pariser Vorort Ivry eine EBR-Vereinbarung geschlossen. Fnac hat 26.000 Beschäftigte in Europa, davon 19.000 allein in Frankreich, und vertreibt Bücher, Tonträger und Konsumelektronik. Bis 2013 war es eine Tochtergesellschaft der Luxusgüterholding PPR und gehörte zu dessen EBR (siehe
Am 6. Dezember 2016 wurde am Sitz der Handelskette Fnac im Pariser Vorort Ivry eine EBR-Vereinbarung geschlossen. Fnac hat 26.000 Beschäftigte in Europa, davon 19.000 allein in Frankreich, und vertreibt Bücher, Tonträger und Konsumelektronik. Bis 2013 war es eine Tochtergesellschaft der Luxusgüterholding PPR und gehörte zu dessen EBR (siehe 

 Am 30. Dezember 2016 wurde am Firmensitz im Pariser Vorort Vélizy-Villacoublay eine erneuerte EBR-Vereinbarung für Eiffage unterzeichnet. Der Europäische Betriebsrat wurde 1998 gegründet und unterliegt vollständig der EBR-Gesetzgebung. Ein großer Teil der weltweit 65.000 Beschäftigten entfällt auf Frankreich, wo es in der Belegschaft eine starke gewerkschaftliche Tradition gibt. 24% des Aktienkapitals halten die Arbeitnehmer.
Am 30. Dezember 2016 wurde am Firmensitz im Pariser Vorort Vélizy-Villacoublay eine erneuerte EBR-Vereinbarung für Eiffage unterzeichnet. Der Europäische Betriebsrat wurde 1998 gegründet und unterliegt vollständig der EBR-Gesetzgebung. Ein großer Teil der weltweit 65.000 Beschäftigten entfällt auf Frankreich, wo es in der Belegschaft eine starke gewerkschaftliche Tradition gibt. 24% des Aktienkapitals halten die Arbeitnehmer. Seit dem 1. Dezember 2016 betreibt die schweizerische UBS ihre Vermögensverwaltung für Kontinentaleuropa von Frankfurt aus und hat hierzu die neue Gesellschaft UBS Europe SE gegründet. Sie hat 2.000 Beschäftigte in neun Ländern. Damit ist Frankfurt jetzt Favorit für die mögliche Verlagerung von 1.500 UBS-Arbeitsplätzen aus London, sollte Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Europäischen Binnenmarkt ausscheiden. Die am 11. August 2016 unterzeichnete SE-Beteiligungsvereinbarung hat hierfür bereits Vorkehrungen getroffen.
Seit dem 1. Dezember 2016 betreibt die schweizerische UBS ihre Vermögensverwaltung für Kontinentaleuropa von Frankfurt aus und hat hierzu die neue Gesellschaft UBS Europe SE gegründet. Sie hat 2.000 Beschäftigte in neun Ländern. Damit ist Frankfurt jetzt Favorit für die mögliche Verlagerung von 1.500 UBS-Arbeitsplätzen aus London, sollte Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Europäischen Binnenmarkt ausscheiden. Die am 11. August 2016 unterzeichnete SE-Beteiligungsvereinbarung hat hierfür bereits Vorkehrungen getroffen. Am 24. Oktober 2016 wurde die Firmengruppe Busch mit Sitz in Maulburg (Schwarzwald) in eine SE umgewandelt. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen 2.600 Arbeitnehmer, die nun komplett von der Mitbestimmung im Aufsichtsrat ausgeschlossen sind. Busch hat weltweit die größte Produktpalette von Vakuumpumpen für die Industrie und versucht gerade, den Konkurrenten Pfeiffer Vacuum aus Hessen aufzukaufen. Sollte die Akquisition gelingen, würde die neue SE auch die Arbeitnehmer von Pfeiffer Vacuum dauerhaft aus dem Aufsichtsrat fernhalten.
Am 24. Oktober 2016 wurde die Firmengruppe Busch mit Sitz in Maulburg (Schwarzwald) in eine SE umgewandelt. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen 2.600 Arbeitnehmer, die nun komplett von der Mitbestimmung im Aufsichtsrat ausgeschlossen sind. Busch hat weltweit die größte Produktpalette von Vakuumpumpen für die Industrie und versucht gerade, den Konkurrenten Pfeiffer Vacuum aus Hessen aufzukaufen. Sollte die Akquisition gelingen, würde die neue SE auch die Arbeitnehmer von Pfeiffer Vacuum dauerhaft aus dem Aufsichtsrat fernhalten.
 Am 24. Januar 2017 unterzeichnete die zentrale Leitung von Veidekke ein internationales Rahmenabkommen mit der Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) für die weltweit 7.000 Arbeitnehmer. Schon 2005 hatte der größte Baukonzern Norwegens zum ersten Mal ein solches Abkommen geschlossen (siehe
Am 24. Januar 2017 unterzeichnete die zentrale Leitung von Veidekke ein internationales Rahmenabkommen mit der Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) für die weltweit 7.000 Arbeitnehmer. Schon 2005 hatte der größte Baukonzern Norwegens zum ersten Mal ein solches Abkommen geschlossen (siehe  Am 3. Februar 2017 verlängerten die zentrale Leitung von Solvay und der Internationale Industriegewerkschaftsbund (industriALL) in Brüssel das weltweite Rahmenabkommen über soziale Verantwortung von 2013 (siehe
Am 3. Februar 2017 verlängerten die zentrale Leitung von Solvay und der Internationale Industriegewerkschaftsbund (industriALL) in Brüssel das weltweite Rahmenabkommen über soziale Verantwortung von 2013 (siehe  Die zentrale Leitung der PSA-Gruppe unterzeichnete am 7. März 2017 am Sitz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf ein weltweit gültiges Rahmenabkommen mit dem Internationalen Industriegewerkschaftsbund (industriALL). Es baut auf dem ersten Abkommen von 2006 auf und integriert den 2010 gegründeten Weltbetriebsrat (siehe
Die zentrale Leitung der PSA-Gruppe unterzeichnete am 7. März 2017 am Sitz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf ein weltweit gültiges Rahmenabkommen mit dem Internationalen Industriegewerkschaftsbund (industriALL). Es baut auf dem ersten Abkommen von 2006 auf und integriert den 2010 gegründeten Weltbetriebsrat (siehe  Die unabhängige Gewerkschaft FABI zählt 100.000 Mitglieder unter den Bankangestellten in Italien. Sie gehört keinem der italienischen Dachverbände an, aber dem europäischen Gewerkschaftsverband UNI für die Dienstleistungsbranche. Mit Gewerkschaften in vier weiteren Ländern führte sie zwei Jahre lang ein EBR-Projekt durch, das von der Europäischen Kommission finanziell gefördert wurde. Die Webseite "To.Be.E.EWC" enthält zahlreiche Info-Bausteine für EBR-Mitglieder.
Die unabhängige Gewerkschaft FABI zählt 100.000 Mitglieder unter den Bankangestellten in Italien. Sie gehört keinem der italienischen Dachverbände an, aber dem europäischen Gewerkschaftsverband UNI für die Dienstleistungsbranche. Mit Gewerkschaften in vier weiteren Ländern führte sie zwei Jahre lang ein EBR-Projekt durch, das von der Europäischen Kommission finanziell gefördert wurde. Die Webseite "To.Be.E.EWC" enthält zahlreiche Info-Bausteine für EBR-Mitglieder. Die Initiative CWC wurde 1999 mit Unterstützung des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) gegründet, um Informationsaustausch und gemeinsame Aktionen zwischen Treuhändern gewerkschaftlicher Pensionsfonds zu fördern. Unternehmen, in die investiert wird, sollen Menschen- und Arbeitsrechte respektieren, finanziell nachhaltig tätig sein und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden.
Die Initiative CWC wurde 1999 mit Unterstützung des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) gegründet, um Informationsaustausch und gemeinsame Aktionen zwischen Treuhändern gewerkschaftlicher Pensionsfonds zu fördern. Unternehmen, in die investiert wird, sollen Menschen- und Arbeitsrechte respektieren, finanziell nachhaltig tätig sein und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden. Seit dem 1. Oktober 2016 haben Leiharbeiter in Belgien das Recht auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag, bevor sie ihre Arbeit beginnen. Ein solcher Vertrag kann auf Papier oder elektronisch abgeschlossen werden. Um über ihre neuen Rechte zu informieren, hat der belgische Gewerkschaftsbund FGTB eine spezielle Webseite erstellt.
Seit dem 1. Oktober 2016 haben Leiharbeiter in Belgien das Recht auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag, bevor sie ihre Arbeit beginnen. Ein solcher Vertrag kann auf Papier oder elektronisch abgeschlossen werden. Um über ihre neuen Rechte zu informieren, hat der belgische Gewerkschaftsbund FGTB eine spezielle Webseite erstellt. Die parteiübergreifende Vereinigung "Open Britain" ist nach dem Referendum über die Mitgliedschaft in der EU entstanden und betreibt eine Webseite mit aktuellen Informationen. Die Unterstützer wollen ein offenes und integratives Land: offen für Handel und Investment, offen für Talente und harte Arbeit, offen gegenüber Europa und der Welt. Das Vereinigte Königreich soll auch nach dem Brexit weiterhin im Europäischen Binnenmarkt zu bleiben.
Die parteiübergreifende Vereinigung "Open Britain" ist nach dem Referendum über die Mitgliedschaft in der EU entstanden und betreibt eine Webseite mit aktuellen Informationen. Die Unterstützer wollen ein offenes und integratives Land: offen für Handel und Investment, offen für Talente und harte Arbeit, offen gegenüber Europa und der Welt. Das Vereinigte Königreich soll auch nach dem Brexit weiterhin im Europäischen Binnenmarkt zu bleiben. Wird die Tarifautonomie von der EU politisch ausgehebelt?
Wird die Tarifautonomie von der EU politisch ausgehebelt? Im November 2016 hat die Europäische Föderation der Bau- und Holzarbeiter (EFBH) einen EBR-Leitfaden vorgelegt, der in einem zweijährigen Projekt mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission entstanden ist. Er enthält wichtige Hintergrundinformationen, wie ein Konsultationsprozess im Europäischen Betriebsrat gestaltet werden kann. Weiterhin ist eine Analyse der EBR-Praxis in 23 Unternehmen der Bau- und Holzindustrie zu finden, die auf Basis von Fragebögen und Interviews mit EBR-Mitgliedern erstellt wurde. Eine Fallstudie über die Fusion von Lafarge und Holcim zeigt die Rolle der beiden Europäischen Betriebsräte (siehe
Im November 2016 hat die Europäische Föderation der Bau- und Holzarbeiter (EFBH) einen EBR-Leitfaden vorgelegt, der in einem zweijährigen Projekt mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission entstanden ist. Er enthält wichtige Hintergrundinformationen, wie ein Konsultationsprozess im Europäischen Betriebsrat gestaltet werden kann. Weiterhin ist eine Analyse der EBR-Praxis in 23 Unternehmen der Bau- und Holzindustrie zu finden, die auf Basis von Fragebögen und Interviews mit EBR-Mitgliedern erstellt wurde. Eine Fallstudie über die Fusion von Lafarge und Holcim zeigt die Rolle der beiden Europäischen Betriebsräte (siehe  Werkzeugkasten für EBR-Mitglieder
Werkzeugkasten für EBR-Mitglieder Im Dezember 2016 ist diese Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung erschienen. Der Fabrikeinsturz in Bangladesch im April 2013 mit 1.100 Toten hatte eine weltweite Diskussion über die Verantwortung der Textilkonzerne für ihre Lieferkette ausgelöst (siehe
Im Dezember 2016 ist diese Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung erschienen. Der Fabrikeinsturz in Bangladesch im April 2013 mit 1.100 Toten hatte eine weltweite Diskussion über die Verantwortung der Textilkonzerne für ihre Lieferkette ausgelöst (siehe  Am 30. und 31. Januar 2017 fand zum neunten Mal in Folge die jährliche Fachtagung der EWC Academy in Hamburg statt. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen in der EBR- und SE-Landschaft sowie der Brexit. Auch Forderungen an die bevorstehende Revision der EBR-Richtlinie wurden anhand mehrerer Studien diskutiert, die der Wissenschaftler Romuald Jagodziñski vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI) in Brüssel vorstellte. Am zweiten Tag fanden zwei Seminare statt: zur Arbeitnehmervertretung im Vereinigten Königreich und zum EU-Recht.
Am 30. und 31. Januar 2017 fand zum neunten Mal in Folge die jährliche Fachtagung der EWC Academy in Hamburg statt. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen in der EBR- und SE-Landschaft sowie der Brexit. Auch Forderungen an die bevorstehende Revision der EBR-Richtlinie wurden anhand mehrerer Studien diskutiert, die der Wissenschaftler Romuald Jagodziñski vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI) in Brüssel vorstellte. Am zweiten Tag fanden zwei Seminare statt: zur Arbeitnehmervertretung im Vereinigten Königreich und zum EU-Recht. Das Präsidium des Europäischen Betriebsrates der BCD Group tagte am 1. und 2. Februar 2017 in Hamburg und ließ sich von der EWC Academy schulen, um die Konsultationsverfahren zu verbessern. Das niederländische Unternehmen ist weltweit einer der größten Dienstleister für Geschäftsreisemanagement. Der Europäische Betriebsrat wurde 2008 gegründet, nachdem BCD die Geschäftsreisesparte des deutschen TUI-Konzerns gekauft hatte. Deutschland ist bis heute eines der wichtigsten Länder innerhalb der BCD Group. Obwohl die EBR-Vereinbarung seit 2008 nicht verändert wurde, können die Standards der neuen EU-Richtlinie zum Konsultationsverfahren vollständig genutzt werden, so wie bei allen Artikel-6-Vereinbarungen.
Das Präsidium des Europäischen Betriebsrates der BCD Group tagte am 1. und 2. Februar 2017 in Hamburg und ließ sich von der EWC Academy schulen, um die Konsultationsverfahren zu verbessern. Das niederländische Unternehmen ist weltweit einer der größten Dienstleister für Geschäftsreisemanagement. Der Europäische Betriebsrat wurde 2008 gegründet, nachdem BCD die Geschäftsreisesparte des deutschen TUI-Konzerns gekauft hatte. Deutschland ist bis heute eines der wichtigsten Länder innerhalb der BCD Group. Obwohl die EBR-Vereinbarung seit 2008 nicht verändert wurde, können die Standards der neuen EU-Richtlinie zum Konsultationsverfahren vollständig genutzt werden, so wie bei allen Artikel-6-Vereinbarungen. Am 22. und 23. Februar 2017 kamen Vertreter der beiden geschäftsführenden Ausschüsse von ZF und TRW Automotive nach Friedrichshafen. Mit Unterstützung der EWC Academy berieten sie über die Struktur eines gemeinsamen EBR. Der drittgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF hatte 2015 das US-Unternehmen TRW gekauft (siehe
Am 22. und 23. Februar 2017 kamen Vertreter der beiden geschäftsführenden Ausschüsse von ZF und TRW Automotive nach Friedrichshafen. Mit Unterstützung der EWC Academy berieten sie über die Struktur eines gemeinsamen EBR. Der drittgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF hatte 2015 das US-Unternehmen TRW gekauft (siehe  Vom 18. bis 21. April 2017 findet unser jährliches Seminar in Montabaur statt (auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Köln, am ICE-Bahnhof). Die folgenden Themen werden parallel angeboten:
Vom 18. bis 21. April 2017 findet unser jährliches Seminar in Montabaur statt (auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Köln, am ICE-Bahnhof). Die folgenden Themen werden parallel angeboten: Seminar zur neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung
Seminar zur neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung Vom 18. bis 20. September 2017 findet in Berlin die fünfte Fachtagung zu den industriellen Beziehungen in den USA statt. Neben einem Rückblick auf die historische Entwicklung wird insbesondere die aktuelle Situation nach den Präsidentschaftswahlen beleuchtet. Das Seminar richtet sich an Betriebsräte aus US-Unternehmen wie auch aus europäischen Unternehmen mit wichtigen Standorten in den USA. Zu den Referenten gehören Hermann Nehls, derzeit Sozialreferent für Arbeitsmarkt, Gesundheit und Soziales an der Deutschen Botschaft in den USA, und Dr. Thomas Greven, Dozent am John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin und ehemaliger Mitarbeiter im Büro von Bernie Sanders.
Vom 18. bis 20. September 2017 findet in Berlin die fünfte Fachtagung zu den industriellen Beziehungen in den USA statt. Neben einem Rückblick auf die historische Entwicklung wird insbesondere die aktuelle Situation nach den Präsidentschaftswahlen beleuchtet. Das Seminar richtet sich an Betriebsräte aus US-Unternehmen wie auch aus europäischen Unternehmen mit wichtigen Standorten in den USA. Zu den Referenten gehören Hermann Nehls, derzeit Sozialreferent für Arbeitsmarkt, Gesundheit und Soziales an der Deutschen Botschaft in den USA, und Dr. Thomas Greven, Dozent am John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin und ehemaliger Mitarbeiter im Büro von Bernie Sanders. Vom 18. bis 20. Oktober 2017 findet ein Seminar in Danzig statt. Es richtet sich an Betriebsräte, die mit der Verlagerung von Abteilungen (Shared Service Center) nach Mittel- und Osteuropa konfrontiert sind. Es besteht die Möglichkeit, sich über den Umgang mit solchen Verlagerungen auszutauschen. Die Arbeitsbeziehungen in Polen und die Rolle polnischer Delegierter im EBR werden ebenfalls behandelt.
Vom 18. bis 20. Oktober 2017 findet ein Seminar in Danzig statt. Es richtet sich an Betriebsräte, die mit der Verlagerung von Abteilungen (Shared Service Center) nach Mittel- und Osteuropa konfrontiert sind. Es besteht die Möglichkeit, sich über den Umgang mit solchen Verlagerungen auszutauschen. Die Arbeitsbeziehungen in Polen und die Rolle polnischer Delegierter im EBR werden ebenfalls behandelt.