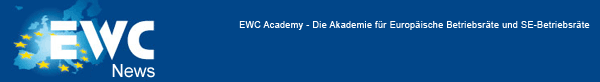 |
| Download als PDF | Newsletter-Archiv |
| This newsletter in English | Cette newsletter en français |
1. Dublin wartet auf zwei Entscheidungen |
 |
|
Irische Regierung äußert sich erstmals öffentlich zum EBR-Recht
Die Europäische Kommission ist der Meinung, dass das irische EBR-Gesetz aus diesem und weiteren Gründen nicht den EU-Standards entspricht und führt seit Mai 2022 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die irische Regierung (siehe Bericht in den EBR-News 2/2022). Wegen der Brisanz der Klage trat der irische Generalstaatsanwalt ("Chief State Solicitor") im Auftrag der Regierung dem Verfahren als Nebenintervenient bei. In der öffentlichen Anhörung beim High Court konnte daher erstmals die juristische Sichtweise des irischen Gesetzgebers studiert werden. Der Generalstaatsanwalt betrachtet das Urteil des Arbeitsgerichtshofs als Fehlinterpretation des irischen EBR-Gesetzes und stützte damit umfassend die Position des EBR. Es gäbe keinen Unterschied zwischen individuellen und kollektiven Ansprüchen, alles müsse im Lichte der EU-Richtlinie interpretiert werden. Auch Rechtsanwaltskosten des EBR müssen nach Meinung der Regierung immer von der zentralen Leitung getragen werden. Die Richterin schließt eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht aus, will in diesem Falle aber die Parteien noch einmal zusammenrufen, um die Vorlagefragen zu formulieren. Der weitere Zeitplan ist derzeit offen.
Arbeitsgerichtshof entscheidet über Schlichtung
Neben der gerichtlichen Klärung von Streitfragen sieht das irische EBR-Gesetz eine Schlichtung vor, eine Art Einigungsstelle. Können sich die Parteien nicht auf die Person des Schlichters einigen, wird er vom Arbeitsgerichtshof bestellt. Während eine solche Entscheidung in anderen Ländern wie z. B. in Deutschland innerhalb kurzer Zeit erfolgt, wartet der EBR von Verizon schon über drei Jahre. Er hatte die Schlichtung im April 2022 beantragt (siehe Bericht in den EBR-News 1/2022). Am 15. September 2025 lud der Arbeitsgerichtshof erstmals zu einer Anhörung, um sich genauer damit zu befassen. Die zentrale Leitung behauptet, eine Schlichtung wäre nur für EBR-Vereinbarungen vorgesehen. Der EBR von Verizon arbeitet jedoch auf Basis der subsidiären Bestimmungen ohne EBR-Vereinbarung. Schon im November 2021 war der EBR des Sprach- und Kulturinstituts British Council damit gescheitert, eine Schlichtung in Irland durchzuführen (siehe Bericht in den EBR-News 3/2024). Er reichte daraufhin eine Beschwerde an die Europäische Kommission, einer der Auslöser des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die irische Regierung. Wann der Arbeitsgerichtshof über Verizon entscheidet, ist derzeit offen. |
2. Entwicklungen auf europäischer Ebene |
 |
|
Nachhaltigkeit - ein neues Thema für den EBR
Der Bericht muss positive und negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt bewerten, dazu gehören Themen wie die Gleichstellung der Geschlechter, Weiterbildung, Entwicklung von Kompetenzen, Arbeitsbedingungen, Löhne und Gehälter, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, gesunde Arbeitsumgebung, Tarifverhandlungen und Mitbestimmung. Die Richtlinie weist Betriebsräten eine formale und aktive Rolle zu. Das Unternehmen soll sie nicht nur informieren, sondern auch die Art und Weise erörtern, wie Informationen für den Bericht beschafft und überprüft werden und den Rat der Betriebsräte an die zuständigen Aufsichtsorgane weiterleiten. Im Juli 2023 legte die Europäische Kommission Standards für die Offenlegung der Berichte vor (siehe Bericht in den EBR-News 3/2023).
Fast alle EU-Mitgliedstaaten haben die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt, in Frankreich, Italien und Belgien wird der Europäische bzw. SE-Betriebsrat im Gesetz sogar ausdrücklich erwähnt. Deren Beteiligung sollte nach Meinung der Gewerkschaften kontinuierlich erfolgen, nicht nur einmal im Jahr. Da es sich um ein neues Thema handelt, empfehlen sie eine eigene Sitzung des gesamten EBR oder des geschäftsführenden Ausschusses, die Bildung einer speziellen Arbeitsgruppe und eine Schulung durch einen Sachverständigen.
Nächster Schritt in Richtung einer EU-Richtlinie über Telearbeit
In der Arbeitswelt werden immer häufiger digitale Hilfsmittel genutzt und die Tätigkeit im Homeoffice nahm in der Corona-Pandemie stark zu, was einen Zwang zur ständigen Erreichbarkeit förderte. Die geplante EU-Richtlinie soll Mindestanforderungen für Telearbeit, z. B. Arbeits- und Ruhezeiten und ein Recht auf Nichterreichbarkeit festlegen, um psychischen Belastungen und Burnout vorzubeugen. In einigen Ländern gibt es dazu schon Gesetze, Frankreich ist Vorreiter. Dort sind Arbeitgeber seit 2016 gesetzlich verpflichtet, Verfahren festzulegen und Schulungen durchzuführen, um den angemessenen Einsatz digitaler Hilfsmittel zu fördern (siehe Bericht in den EBR-News 3/2024).
Pressemitteilung der Europäischen Kommission Download des Konsultationsdokuments |
3. Mitbestimmung in einzelnen Ländern |
 |
|
Italien erlaubt erstmals Mitbestimmung im Aufsichtsrat
Während der linke Gewerkschaftsbund CGIL (5,2 Mio. Mitglieder) von einer "Mogelpackung" spricht, betrachtet der christliche Gewerkschaftsbund CISL (4,1 Mio. Mitglieder) das Gesetz als seinen Erfolg. Die CISL hatte eine Volksinitiative initiiert, die 400.000 Unterschriften sammelte. Die rechte Regierung halbierte jedoch den Gesetzentwurf, von 22 Artikeln im ursprünglichen Entwurf haben nur 15 überlebt. Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist freiwillig. Auch Gewinnbeteiligung und die paritätischen Ausschüsse sind nicht obligatorisch, sondern eine Wahlmöglichkeit für Unternehmen basierend auf Tarifverträgen. Beim nationalen Wirtschafts- und Arbeitsrat (CNEL) wird eine ständige Kommission aus Experten und Sozialpartnern errichtet, die die Weiterentwicklung des Gesetzes überwachen soll.
Italienische Gewerkschaften tun sich schwer mit Mitbestimmung
Traditionell ist das italienische System der Arbeitsbeziehungen stärker konfrontativ geprägt. Es fehlen Erfahrungen mit Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichts- oder Verwaltungsrat, wie sie in Skandinavien sogar in kleinen Firmen üblich sind und in Deutschland, Österreich und Luxemburg umfassend gelten. Italien gehört mit Belgien und Spanien zu einer kleinen Gruppe westeuropäischer Länder, die keine praktischen Erfahrungen damit haben. Die Frage war auch im Kreis der europäischen Gewerkschaften lange Zeit umstritten. Erst im Oktober 2014 verständigten sie sich darauf, überall eine Beteiligung von Arbeitnehmern in der Corporate Governance zu fordern (siehe Bericht in den EBR-News 4/2014).
Erläuterung der Inhalte des Gesetzes Modernisierung der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland
Stellungnahmen der fünf Landesregierungen Einfluss französischer Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat
Die Anteilseignerseite der untersuchten Verwaltungsräte setzt sich aus Vertretern der Wirtschaftseliten zusammen (Absolventen einer Grande École, Besetzung von Spitzenpositionen in anderen Teilen der Wirtschaft). Die Debatten zeichnen sich durch eine große formale Höflichkeit aus, im Gegensatz zur Diskussionskultur in Betriebsratssitzungen. Die Arbeitnehmervertreter müssen sich daher - stärker als in Deutschland - an einen Habitus anpassen, der ihnen bis dahin fremd war. Der Inhalt der Sitzungen wird weitgehend von der Geschäftsleitung bestimmt, die ihre strategischen Projekte selbst entwickelt und dem Aufsichts- oder Verwaltungsrat lediglich vorstellt. Die Arbeitnehmervertreter berichten, dass die Anteilseigner primär eine finanzielle Perspektive auf das Unternehmen einnehmen, die weit von der alltäglichen Realität der Belegschaft entfernt ist.
Wer sind die Arbeitnehmervertreter?
Es handelt sich meist um Männer mit einem Durchschnittsalter von 51 Jahren (Anteilseignervertreter 58 Jahre), viele davon sind Angestellte mit Universitätsabschluss und guten Englischkenntnissen, nur 6% sind einfache Angestellte oder Arbeiter. Die CFDT ist mit 21% besonders stark, die CGT mit 10% nur schwach vertreten. Die überwiegende Mehrheit hatte zahlreiche Mandate in der Gewerkschaft und den unterschiedlichen Betriebsratsgremien. Beim Eintritt in den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat muss man diese in Frankreich aufgeben (siehe Bericht in den EBR-News 4/2022). Der Autor kommt zu dem Schluss, dass es nicht ausreicht, die Anzahl der Arbeitnehmervertreter auf ein Drittel zu erhöhen, wie in Österreich oder in mittelgroßen Unternehmen in Deutschland. Viel wichtiger wären ausreichende Arbeitsmittel, auf die sie sich stützen können.
Beschreibung des Forschungsansatzes der Studie Vorschläge zur Erweiterung der Mitbestimmung |
4. Schwaches Wirtschaftswachstum und Personalabbau |
 |
|
Deutschland und Frankreich mit entgegengesetzen Entwicklungen
In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 wurden 135.000 Arbeitsplatzverluste angekündigt, dem stehen 114.000 angekündigte neue Arbeitsplätze gegenüber. Während sich in vielen EU-Ländern der Saldo aus Abbau und Aufbau mehr oder weniger die Waage hält, weist Deutschland einen Minussaldo von 40.400 Arbeitsplätzen auf. Auch Tschechien (-7.700) und Schweden (-6.700) sind besonders stark negativ betroffen, vor allem wegen der Automobilindustrie. Bei Škoda in Tschechien fallen 5.500 Jobs weg, bei Volvo in Schweden 1.200. Auch die Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt mit 4.000 Arbeitsplätzen macht sich negativ bemerkbar. Damit setzt sich eine Tendenz fort, die sich bereits 2024 in dieser Branche zeigte (siehe Bericht in den EBR-News 4/2024). Betrachtet man den Positivsaldo, so steht Frankreich an erster Stelle mit +35.300 Arbeitsplätzen, Irland folgt mit +7.000, auch Spanien (+3.300) und Portugal (+1.900) stechen positiv hervor. Sämtliche Zahlen stammen vom Europäischen Restrukturierungsmonitor (siehe Bericht in den EBR-News 2/2020).
Die Datenbank des Restrukturierungsmonitors
Wo entstehen die neuen Arbeitsplätze in Frankreich?
Der Personaldienstleister Adecco sucht 8.365 neue Angestellte im medizinischen, paramedizinischen und sozialen Bereich. Der Baukonzern Vinci stellt im laufenden Jahr 6.000 Bauarbeiter ein. RATP, die staatliche Betreibergesellschaft des Métro- und Busnetzes im Großraum Paris, stockt die Belegschaft um 10% auf (5.500 neue Stellen). Die Supermarktkette Intermarché stellt in Südfrankreich 4.800 neue Arbeitnehmer ein. Der Stromnetzbetreiber Enedis sucht 3.380 neue Beschäftigte die ganz Frankreich. Der Technologiekonzern Thales stärkt sein Programm zur Kompetenzentwicklung mit 3.000 neuen Auszubildenden. Der größte Personalabbau des Jahres findet beim Wein- und Spirituosenhersteller Moët Hennessy statt. Dort werden 1.200 Jobs wegfallen, jedoch ohne betriebsbedingte Kündigungen. Im November 2024 versuchte das Unternehmen, die Cognac-Produktion nach China zu verlagern, um Zölle zu vermeiden. Die Belegschaft in Frankreich streikte, was zum Stopp des Projekts führte.
Wo fallen in Deutschland Jobs weg?
Der größte Personalabbau, der seit Anfang 2025 verkündet wurde, betrifft die Automobilindustrie: Audi streicht 7.500 und Porsche 1.900 Arbeitsplätze. Siemens baut 2.850 Arbeitsplätze in Deutschland ab, hauptsächlich im Geschäft mit Elektrofahrzeugen. Das Logistikunternehmen DHL (ehemals Deutsche Post) baut 8.000 Arbeitsplätze im Post- und Paketdienst ab. Die Commerzbank, eines der größten deutschen Kreditinstitute, streicht 3.300 Stellen. Die meisten neuen Arbeitsplätze (1.500) will Coolblue schaffen, ein niederländisches Einzelhandelsunternehmen für Elektrogeräte, das in Deutschland viele neue Filialen plant. Besonders fatal war die Entscheidung des US-Halbleiterherstellers Intel, ein Viertel seiner weltweiten Belegschaft abzubauen und die geplanten Chip-Fabriken in Magdeburg und Breslau (siehe Bericht in den EBR-News 2/2023) nicht zu bauen. |
5. Aktuelle Gerichtsentscheidungen |
 |
|
Mailadresse für jedes einzelne Betriebsratsmitglied
Betriebsräte gibt es bei Netto nicht in jeder Filiale, sondern standortübergreifend in den Regionen. Der Rechtsstreit betrifft den Betriebsrat der Region 5 mit Sitz in Hodenhagen, der für die Belegschaft in Nordwestdeutschland zuständig ist. Er hat 35 Mitglieder, die Gewerkschaft ver.di konnte nur 13 Sitze erzielen und steht häufig im Konflikt mit der arbeitgebernahen Mehrheit. Die Situation ist vergleichbar mit Tesla, wo arbeitgeberfreundliche leitende Angestellte den Betriebsrat dominieren und die IG Metall in der Minderheit ist. Die Geschäftsleitung von Netto stellt einigen (arbeitgebernahen) Mandatsträgern persönliche Adressen zur Verfügung, alle anderen müssen über eine Sammeladresse kommunizieren, die von allen Betriebsratsmitgliedern einsehbar ist. Ein vertraulicher Kontakt der Belegschaft zu den gewerkschaftlich organisierten Betriebsratsmitgliedern ist nicht möglich. Am 13. Juni 2025 legte die Geschäftsleitung Rechtsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht ein.
Können einzelne Betriebsratsmitglieder klagen?
Normalerweise ist ein deutscher Betriebsrat (auch Europäische Betriebsräte in den meisten Ländern) nur als Kollektivorgan in der Lage, Rechte vor Gericht geltend zu machen. Das Urteil der Richter aus Hannover bricht mit diesem Grundsatz. Jedes einzelne Betriebsratsmitglied kann eigene Ansprüche auf Bereitstellung von Sachmitteln geltend machen, sofern diese für die Tätigkeit erforderlich sind. Ein Beschluss des Betriebsrats ist in solchen Fällen nicht notwendig. Andernfalls könnte die Mehrheit des Betriebsrats die Bereitstellung von Sachmitteln für eine Minderheit verhindern. Dies gilt jedoch nicht beim Schulungsanspruch, der nur vom Betriebsrat kollektiv beschlossen werden kann. Was passiert aber, wenn die Mehrheit eine Minderheit von Schulungen ausschließt? In diesem Fall, so das Gericht, müssten die betreffenden Betriebsratsmitglieder zunächst gerichtlich gegen den Betriebsrat vorgehen - mit dem Ziel, dass dieser einen positiven Beschluss über die Erforderlichkeit der Schulung trifft und den Arbeitgeber auffordert, die Schulung zu bezahlen.
Betriebsrat verliert Statusverfahren in zweiter Instanz
Das Kammergericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz vom Dezember 2024, wonach die Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat der Bank nicht eingeführt werden muss. Lediglich 370 Arbeitnehmer sind der Holding zuzurechnen, die übrigen 800 Arbeitnehmer in zwei Tochtergesellschaften nicht. Sie bilden juristisch gesehen keinen Gemeinschaftsbetrieb, obwohl alle im gleichen Gebäude arbeiten. In einem Gemeinschaftsbetrieb wird die HR-Funktion für alle Tochtergesellschaften wahrgenommen und ein übergreifender Personaleinsatz praktiziert. Diese Grundsatzfrage wurde vom Bundesarbeitsgericht allerdings noch nie geklärt. Daher hat das Kammergericht Berlin die Rechtsbeschwerde ausdrücklich zugelassen. Derweil geht die Geschäftsleitung der Bank gerichtlich gegen den Betriebsrat vor und will ihn auflösen, mindestens aber den Vorsitzenden absetzen lassen.
Bericht über die Klage gegen den Betriebsrat
Drittelbeteiligungslücke in der politischen Diskussion
Das Grundproblem im Rechtsstreit bei N26 ist seit längerem bekannt. Eine Gesetzeslücke ermöglicht es vielen mittelgroßen Unternehmen zwischen 500 und 2.000 Beschäftigten durch Aufgliederung in eine Holding und verschiedene Tochtergesellschaften die Mitbestimmung im Aufsichtsrat zu umgehen. Wächst das Unternehmen an die Schwelle von 2.000 Beschäftigten heran, kann dieser Status durch Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) auf Dauer aufrechterhalten werden, so wie im Fall von N26 (siehe Bericht in den EBR-News 2/2024). Die Hans-Böckler-Stiftung fordert den Gesetzgeber regelmäßig dazu auf, diese Gesetzeslücke zu schließen. Eine Studie der Universität Jena zeigte im Juni 2024 das Ausmaß an Mitbestimmungsflucht (siehe Bericht in den EBR-News 2/2024). |
6. Transnationale Betriebsvereinbarungen |
 |
|
Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz in belgischem Chemiekonzern Am 23. Januar 2025 unterzeichneten der Europäische Betriebsrat und die zentrale Leitung von Syensqo in Brüssel eine Rahmenvereinbarung zum digitalen Wandel und über die Nutzung Künstlicher Intelligenz. Darin ist ein regelmäßiger Austausch zwischen dem EBR und den Teams für digitales Management vorgesehen. Dem geschäftsführenden Ausschuss werden alle drei Monate digitale und KI-Projekte vorgelegt, bevor sie umgesetzt werden. Bei Vorhaben von größerer Bedeutung findet ein Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren statt, das dem Projektumfang entspricht. Fester Bestandteil der Einführung neuer digitaler Tools ist ein Programm zur Schulung, Umschulung und Weiterbildung. Die Einhaltung der Grundsätze des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, darunter das Recht auf Nichterreichbarkeit, werden garantiert.
Syensqo hat 13.000 Beschäftigte in 30 Ländern (davon 40% in Europa) und wurde im Dezember 2023 aus dem Chemiekonzern Solvay abgespalten. Neben dem EBR gibt es - wie bei Solvay - auch einen Weltbetriebsrat (siehe Bericht in den EBR-News 1/2024). Dieser hat das Rahmenabkommen ebenfalls unterzeichnet. Somit gilt es nicht nur in Europa, sondern weltweit. Beide Betriebsräte präsentieren ihre beispielgebende Arbeit auf einer öffentlich zugänglichen Webseite. Dort sind auch die Geschichte der beiden Gremien, ihre Arbeit und ihre Erfolge dargestellt.
Die Webseite des Europäischen und des Weltbetriebsrates Die EBR-Vereinbarung von Syensqo Die Rahmenvereinbarung zum digitalen Wandel SE-Betriebsrat regelt Unfallverhütung in Pflegeheimen
Pressemitteilung des Unternehmens Pressemitteilung der Gewerkschaften |
7. Überarbeitete EBR-Vereinbarungen |
 |
|
Schweizer Chemie- und Pharmakonzern erneuert EBR-Vereinbarung
Schulungen finden normalerweise für die einzelnen Delegierten in den jeweiligen Ländern statt, nur in speziellen Fällen ist eine Schulung im Rahmen einer EBR-Sitzung vorgesehen. Zu allen Sitzungen wird ein hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär aus der Schweiz eingeladen, dessen Reisekosten vom Unternehmen getragen werden. Kosten für Sachverständige oder Rechtsberatung in Spanien werden in der EBR-Vereinbarung nicht erwähnt, weshalb die Anforderungen der neuen EBR-Richtlinie noch nicht erfüllt sind. Allerdings ist eine Kündigung der EBR-Vereinbarung zum Ende jedes Kalenderjahres möglich. Danach bleibt sie für ein weiteres Jahr in Kraft. Ob der EBR danach aufgelöst wird oder die subsidiären Bestimmungen des spanischen EBR-Gesetzes gelten, ist nicht geklärt. Französischer Mischkonzern mit fast verdoppelter Belegschaft
Der EBR wird von 27 auf 42 Mitglieder vergrößert, davon kommt die Hälfte aus Frankreich. Sie tagen bis zu zweimal im Jahr. Der geschäftsführende Ausschuss hat weiterhin fünf Mitglieder. Zusätzlich gibt es drei thematische Ausschüsse: für Arbeits- und Gesundheitsschutz, für Klima und Umwelt und für die Überwachung der sozialen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Equans. Im April 2022 hatte die zentrale Leitung ein Protokoll unterzeichnet, das eine Beschäftigungsgarantie von fünf Jahren nach dem Betriebsübergang beinhaltet (siehe Bericht in den EBR-News 2/2022). Die EBR-Vereinbarung sieht auch ein Konsultationsverfahren für soziale Verpflichtungen auf europäischer Ebene zu Querschnittsthemen vor, die zu transnationalen Betriebsvereinbarungen führen können.
Ersatz für fehlende Gesamtbetriebsräte
Im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Belgien werden lokale EBR-Ausschüsse gebildet, als Ersatz für die in diesen Ländern gesetzlich nicht verankerten Gesamtbetriebsräte. Sie tagen einmal jährlich unter dem Vorsitz des Managements und in Anwesenheit des EBR-Sekretärs. Den Vorsitz im EBR übt nach französischem Modell weiterhin der Vorstandsvorsitzende persönlich aus, der Sohn des Firmengründers. Sämtliche laufenden Kosten der EBR-Arbeit trägt das Unternehmen, zusätzlich erhält der EBR ein eigenes Budget, das auf jährlich 50.000 € verdoppelt wird. EBR-Gründung vor Börsengang und ohne Zeitverzug
Bericht über die Abspaltung der Eiscreme-Sparte Präsentation des neuen Unternehmens Bericht über die Investitionen in Deutschland |
8. Aktuelle SE-Umwandlungen |
 |
|
SE-Betriebsrat mit Inklusionsbeauftragtem und Jugendvertreter
Die am 21. Mai 2025 geschlossene SE-Beteiligungsvereinbarung bezieht das Vereinigte Königreich und die Schweiz ein. Der künftige SE-Betriebsrat hat 13 Mitglieder und kann bei weiterem Wachstum der Belegschaft auf 21 aufgestockt werden. Er wählt einen Vorsitzenden und vier weitere Mitglieder in den geschäftsführenden Ausschuss, einen Beauftragten für Gleichbehandlung und Inklusion sowie einen Jugendvertreter, der sich um die besonderen Anliegen der Arbeitnehmer bis 25 Jahre kümmert. Sitzungen finden halbjährlich statt, eine davon als Videokonferenz. Der geschäftsführende Ausschuss bekommt zusätzlich zweimal im Jahr ein Video-Update durch die zentrale Leitung.
Bei personellen Maßnahmen ist der SE-Betriebsrat bereits zuständig, wenn lediglich zehn Beschäftige in zwei Ländern oder zwanzig in einem einzigen Land betroffen sind. Allerdings gibt es einen engen Zeitplan für die Unterrichtung und Anhörung. Er hat nach der Sitzung nur eine Woche Zeit, um seine Stellungnahme abzugeben. Das SE-typische doppelte Konsultationsverfahren fehlt völlig. Andererseits stehen ihm Initiativrechte zu länderübergreifenden Themen zu. In den vom Management organisierten Belegschaftsversammlungen ("Townhall meetings") darf der SE-Betriebsrat bis zu fünf Fragen stellen, die das Management beantworten muss. Er kann auch Themen für die jährliche Mitarbeiterbefragung vorschlagen. Bei Streitigkeiten über die Auslegung der SE-Vereinbarung wird eine Schlichtungsstelle aus jeweils drei Mitgliedern und einem neutralen Vorsitzenden gebildet, erst danach ist der Gang zum Arbeitsgericht möglich.
Mitbestimmung im Verwaltungsrat erst nach Ausscheiden des Firmengründers
Da es zum Zeitpunkt der SE-Umwandlung keine Mitbestimmung bei Brainlab gab, bleibt dieser Status auf Dauer erhalten. Allerdings konnten die Arbeitnehmer ein Zugeständnis durchsetzen. Scheidet der Firmengründer aus dem Verwaltungsrat aus, wird ein Arbeitnehmervertreter dort hineingewählt. Der SE-Betriebsrat kann einen Kandidaten vorschlagen, der Verwaltungsrat ist daran aber nicht gebunden. Er kann auch einen anderen Vertreter aus der Belegschaft benennen.
Pressemitteilung zur SE-Umwandlung Hamburger Versicherungsgesellschaft vermeidet paritätische Mitbestimmung
Der künftige SE-Betriebsrat hat 14 Mitglieder, davon 10 aus Deutschland. Der Vorsitzende ist zu 100% von seiner beruflichen Tätigkeit freigestellt. Das Vereinigte Königreich und die Schweiz gehören zum Geltungsbereich und erhalten Mandate, sobald die SE dort mehr als 35 Arbeitnehmer hat. Jedes Jahr gibt es zwei Sitzungen des SE-Betriebsrates, dabei "ist ein Rahmen zu schaffen, der einen informellen Austausch sowohl unter den SE-Betriebsratsmitgliedern als auch mit dem Vorstand ermöglicht". Auf Wunsch des SE-Betriebsrates können auch Videokonferenzen statt Präsenzsitzungen stattfinden. Der geschäftsführende Ausschuss besteht aus fünf Mitgliedern.
Die Themen der Unterrichtung und Anhörung gehen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus. Dazu gehören z. B. auch wesentliche Änderungen der Vertragsbeziehungen innerhalb der SE und im Hinblick auf konzernfremde Unternehmen, soweit diese die Interessen der Arbeitnehmer in mehr als einem Land betreffen. Der SE-Betriebsrat ist zu beteiligen, wenn mindestens 5% der Arbeitsplätze an einem Standort von einer beabsichtigten Verlagerung oder Stilllegung betroffen sind. Inklusive des SE-typischen doppelten Konsultationsverfahrens sind dafür bis zu acht Wochen vorgesehen. Die zentrale Leitung darf in dieser Zeit keine Maßnahmen umsetzen. Zur Beilegung von Streitigkeiten wird ad hoc eine paritätisch besetzte Einigungskommission gebildet.
Pressemitteilung zur SE-Umwandlung Deutsche SE-Umwandlung ohne deutsche Betriebsräte
Sie trafen sich am 18. März 2025 in Münster zu einer Sitzung, die eine Stunde 45 Minuten dauerte und mit der Annahme einer SE-Beteiligungsvereinbarung endete. Der Text war von der Anwaltskanzlei des Arbeitgebers vorbereitet worden und Protokollführer der Sitzung war der Rechtsanwalt des Unternehmens. Die Delegierten hatten zwar Unterstützung durch Dolmetscher, aber keine Schulung erhalten noch einen Sachverständigen hinzugezogen. Für den SE-Betriebsrat gilt die Auffangregelung des Gesetzes, einzige konkrete Regelung ist die Begrenzung der Freistellung auf ein bis zwei Tage pro Jahr zusätzlich zu den Sitzungszeiten. Eine Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist auf Dauer komplett ausgeschlossen.
Pressemitteilung zur SE-Umwandlung |
9. Der Blick über Europa hinaus |
 |
|
Dänischer Molkereikonzern erlaubt weltweite Betriebsbesuche
Die Vereinbarung garantiert einen Betriebsbesuch im Rahmen der halbjährlichen Treffen zwischen Management und acht Vertretern der IUL. Dabei können Themen wie nachhaltige Beschäftigung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Zwangsarbeit, sexuelle Belästigung, Gleichstellung der Geschlechter und die Bewältigung der Klimakrise angesprochen werden. Das Unternehmen trägt die Reisekosten der Gewerkschaftsvertreter. Weltweit hat Arla 20.000 Beschäftigte mit besonders starkem Wachstum in Afrika und im Nahen Osten. Nach einem Beschluss vom 18. Juni 2025 wird Arla mit dem Deutschen Milchkontor (DMK) fusionieren, wodurch die größte Molkereigenossenschaft Europas entsteht.
Bericht von der Unterzeichnung Psychische Gesundheit bei Tech-Moderatoren
Der Bericht von UNI Global basiert auf Umfragen und Interviews mit Moderatoren in sechs Ländern (darunter Kolumbien, Tunesien, Türkei). Danach sind sie täglich psychischen Belastungen ausgesetzt, die in jeder anderen Branche inakzeptabel wären. Algorithmusgesteuerte Quoten zwingen sie dazu, gewalttätige, verstörende und schädliche Inhalte in unangemessener Geschwindigkeit zu bearbeiten. UNI Global hat acht Forderungen formuliert, um die psychische Gesundheit der Beschäftigten in der gesamten Lieferkette zu schützen. Der Aufruf ist die erste Aktion der globalen Gewerkschaftsallianz der Content-Moderatoren, die am 30. April 2025 in Nairobi (Kenia) von Vertretern aus neun Ländern gegründet wurde.
Pressemitteilung von UNI Global Bericht über die Gründung der Gewerkschaftsallianz Bericht über Proteste von TikTok-Beschäftigten in Berlin 25 Jahre internationale Sozialcharta Im März 2000 schloss die zentrale Leitung des Stifte- und Kosmetikhersteller Faber-Castell mit den Gewerkschaften eine weltweite Sozialcharta, damals eine der ersten ihrer Art überhaupt. Sie enthält Mindeststandards beim Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Achtung der Koalitionsfreiheit und das Verbot von Kinderarbeit. Das 1761 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Stein bei Nürnberg (Foto) hat weltweit 6.400 Beschäftigte und zehn Produktionsstätten, u. a. in Brasilien, Peru, Indonesien und China. In Deutschland sind 1.200 Menschen bei Faber-Castell beschäftigt. Seit 2009 gilt eine erweiterte Fassung der Sozialcharta (siehe Bericht in den EBR-News 1/2009). Ihre Einhaltung wird von einem Überwachungsausschuss regelmäßig bei Besuchen in den Standorten überprüft, auch die Bedingungen bei Zulieferern. In Peru wurden z. B. Asbest-Dächer komplett ausgetauscht.
Bericht über die Arbeit des Überwachungsausschusses |
10. Webseiten und Kampagnen |
 |
|
Juristisches Netzwerk des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) Auf einer speziellen Webseite behandelt der EGB juristische Fragen im Zusammenhang mit Arbeitsbeziehungen, Sozialer Dialog, Europäischer Betriebsrat, Arbeitsbedingungen sowie Tarifrecht und Entlohnung, um den innergewerkschaftlichen Informationsaustausch und Zugang zu Rechtskompetenz und Know-how zu verbessern. So werden z. B. ausgewählte Gesetzgebungsentwicklungen auf europäischer, nationaler und internationaler Ebene dargestellt. Es gibt auch Links zu relevanten Quellen des europäischen und internationalen Rechts. Die Datenbank enthält eine Auswahl europäischer, nationaler und internationaler Rechtsprechung mit Relevanz im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht sowie im Sozial- und Tarifrecht. Einige Teile der Webseite sind öffentlich, andere Teile nur mit Passwort zugänglich.
Die Webseite des juristischen Netzwerks Toolbox für digitale gewerkschaftliche Arbeit Seit Januar 2025 ist eine Webseite verfügbar, die viele Aspekte digitaler Kommunikation für Gewerkschaften in einer Toolbox beleuchtet. Unter der Leitung des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) wurde sie in einem zweijährigen Projekt mit fünf nationalen Workshops entwickelt, finanziert durch die Europäische Union. Die Toolbox soll nationalen Gewerkschaften helfen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden und ihre Mitgliederzahlen zu steigern. Die damit verbundenen Herausforderungen werden in eigenen Kapiteln behandelt: Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen, Schritt halten mit sich ständig weiterentwickelnden Kommunikationstrends, Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung, Mitgliederwerbung, Online-Kampagnen sowie Rechtsvorschriften im Online-Bereich. Die Elemente der Toolbox sind auf der Webseite online verfügbar und können als Broschüre in zwölf Sprachen heruntergeladen werden.
Download der Toolbox-Broschüre Bessere Arbeitnehmerrechte in Irland gefordert "Respect at Work" ist eine Kampagne, die von vier Gewerkschaften in Irland im Vorfeld der Parlamentswahl vom 29. November 2024 lanciert wurde. Alle Kandidaten sollten folgende Erklärung unterzeichnen: "Ich verspreche, Gesetze zu unterstützen, die Tarifverhandlungen fördern, Arbeitnehmervertreter schützen und das Recht auf Zugang zu einer Gewerkschaft am Arbeitsplatz gewährleisten." Irland gehört zu den Ländern mit den schwächsten Arbeitnehmerrechten in Westeuropa. In lediglich zwei EU-Ländern gibt es für Arbeitnehmervertreter keinerlei Kündigungsschutz: Südzypern und Irland. Mehr als die Hälfte der 174 gewählten Abgeordneten hatten die Erklärung unterzeichnet, darunter viele von der Opposition, aber auch einige aus den Reihen der konservativen Regierungsparteien. Die neue Regierung versprach einen Aktionsplan zur Stärkung von Tarifverhandlungen.
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Informationen zum Mindestlohn in Deutschland Seit 1. Januar 2015 gibt es in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn, der damals 8,50 € pro Stunde betrug. Derzeit liegt er bei 12,82 € und wird bis 2027 auf 14,60 € steigen. Für die Festsetzung des Mindestlohns ist eine neunköpfige Kommission zuständig, die von der Bundesregierung berufen wird. Sie besteht aus einer Vorsitzenden, drei Arbeitnehmer- und drei Arbeitgebervertretern und zwei nicht stimmberechtigten Wissenschaftlern. In einer Pattsituation entscheidet die Vorsitzende. Für die Kontrolle ist die Zollverwaltung zuständig. Ein Arbeitgeber, der gegen das Mindestlohngesetz verstößt, kann mit einem Bußgeld belegt und von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Auf ihrer Webseite informiert die Mindestlohnkommission über ihre Beschlüsse und den Inhalt des Gesetzes. Außerdem können dort Forschungsergebnisse und Publikationen abgerufen werden. Die Webseite ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.
Die Webseite der Mindestlohnkommission Überblick über höhere Mindestlöhne in einzelnen Branchen DGB-Broschüre "10 Jahre Mindestlohn" |
11. Neue Publikationen |
 |
|
Wie funktioniert Kolonialismus im digitalen Zeitalter? Ende April 2025 ist dieses Sachbuch erschienen, eine gut lesbare Mischung aus tiefgreifender Analyse und bewegenden Reportagen über Kolonialismus im digitalen Zeitalter. Statt physisches Land einzunehmen, erobern heutige Kolonialherren den digitalen Raum. Die Autoren zeigen, wie Tech-Konzerne Kobalt aus dem Kongo und Lithium aus Südamerika für Smartphones und E-Autos unter katastrophalen Bedingungen für Mensch und Umwelt beziehen. In Kenia und Indien arbeiten Content-Moderatoren ("Putzcrew des Internet") in digitalen Sweatshops, wo sie verstörende Inhalte aus Datenströmen filtern und KI-Systeme trainieren - unter prekären Bedingungen für niedrige Löhne (siehe Bericht weiter oben). Im Kolonialismus von heute fließen Daten und Profite nur in eine Richtung, während der versprochene Wohlstand für den globalen Süden und rohstoffreiche Länder ausbleibt. Die Autoren beleuchten auch die Rolle Europas neben den Digitalimperien USA und China.
Weitere Informationen zum Buch KI-Praxishandbuch für Betriebsräte Im Mai 2025 ist dieses Praxishandbuch erschienen, das den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Betrieben und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates untersucht. Mit Musterformulierungen und Checklisten zeigt es Lösungsansätze für gute betriebliche Regelungen auf. Die Themen reichen von den rechtlichen Rahmenbedingungen der neuen KI-Verordnung (siehe Bericht in den EBR-News 3/2024) bis hin zur Frage, wie Betriebsräte den Einsatz von KI überwachen und steuern können. KI eröffnet neue Chancen, wirft aber auch Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes, der Gerechtigkeit und der Transparenz auf. Das Buch beginnt mit einer kurze Historie der KI bis 1980 und deren technischen Grundlagen und untersucht den Begriff KI nach drei Risikogruppen. Ein Schwerpunkt liegt beim Einsatz von KI im Personalwesen, insbesondere bei Personalabbau. Welche Rechte hat der Betriebsrat? Wie kann der Betriebsrat zwischen guter und schlechter KI unterscheiden? Worauf muss er bei KI-Vereinbarungen achten?
Arbeitnehmerbeteiligung beim sozial gerechten Umbau der Industriegesellschaft Am 10. Juni 2025 ist eine Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel erschienen, die einen Vorschlag mit 23 Artikeln für eine EU-Richtlinie zum gerechten Strukturwandel ("just transition") unter Beteiligung der Betroffenen enthält. Heute sind Betriebsräte und Gewerkschaften an Umstrukturierungen sehr begrenzt, zu spät oder nur symbolisch beteiligt. Die neue Richtlinie will Mindeststandards für deren Teilhabe an strategischen Entscheidungen zum klimaneutralen und digitalen Umbau von Unternehmen festschreiben. Bei ihrem Amtsantritt hatte die Sozialkommissarin Roxana Mînzatu angekündigt, einen Fahrplan für hochwertige Arbeitsplätze ("Quality Jobs Roadmap") mit den Sozialpartnern zu diskutieren, insbesondere zum Umbau der Wirtschaft (siehe Bericht in den EBR-News 4/2024). Dabei soll die vom Europäischen Parlament geforderte EU-Richtlinie zur Aufsichtsratsmitbestimmung (siehe Bericht in den EBR-News 4/2021) auch eine Rolle spielen.
Download der Broschüre mit dem Richtlinienvorschlag Webseite des Europäischen Industriegewerkschaftsbundes zum Thema Gewerkschaftliches Manifest für einen gerechten Strukturwandel Unternehmerische Sorgfaltspflichten Am 25. Juni 2025 legte die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Leitfaden mit zehn Argumenten vor, warum Lieferkettengesetze für eine nachhaltige und soziale Wirtschaft unumgänglich sind. Sie enthalten gesetzliche Verpflichtungen zum Schutz von Mensch und Umwelt und gelten als entscheidender Baustein für eine sozial gerechte Globalisierung. Viele Menschen kennen unfaire Löhne, Ausbeutung, Kinderarbeit, sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, beschränkte Gewerkschaftsrechte oder mangelhafte Brand- und Gebäudesicherheit. Die EU-Richtlinie zur Sorgfaltspflicht ("Corporate Sustainability Due Diligence") steht weiter in der Kritik und wurde kürzlich auf Juli 2028 verschoben (siehe Bericht in den EBR-News 2/2025). Die deutsche Bundesregierung will das deutsche Lieferkettengesetz (siehe Bericht in den EBR-News 1/2023) durch ein Gesetz zur internationalen Unternehmensverantwortung ersetzen.
Hintergrundinformationen zur Sorgfaltspflicht in Lieferketten |
12. Die EWC Academy: Beispiele aus unserer Arbeit |
 |
|
Verhandlungen zur SE-Umwandlung Seit dem 13. Juni 2025 berät die EWC Academy das Besondere Verhandlungsgremium von Contemporary Amperex Technology Thuringia (CATL). Das chinesische Unternehmen ist der größte Hersteller von Batterien für Elektroautos der Welt und zählt zu den zehn größten Automobilzulieferern. Derzeit gibt es in Europa erst einen einzigen Produktionsstandort in Arnstadt (Thüringen). Werke in Ungarn und Spanien sind im Bau oder in Planung. Das Besondere Verhandlungsgremium hat daher nur deutsche Mitglieder. Im Zusammenhang mit der SE-Umwandlung läuft seit Mai 2025 vor dem Landgericht Erfurt bereits ein Statusverfahren. Der Betriebsrat will eine dauerhafte Flucht aus der Mitbestimmung im Aufsichtsrat verhindern (siehe Bericht in den EBR-News 2/2025). Einblick in Investitionsprogramme gefordert Seit dem 30. Juni 2025 berät die EWC Academy den Europäischen Betriebsrat von Nordzucker. Der deutsche Zuckerproduzent mit Sitz in Braunschweig hat 4.100 Beschäftigte und seit 2004 einen EBR. Ihm gehören Vertreter aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Litauen, Polen und der Slowakei an. Seiner Meinung nach berichtet die zentrale Leitung unzureichend über die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung. Es fehlt ihm auch die Unterrichtung über Investitionsprogramme. Mit Unterstützung durch Berater will er Beteiligungsrechte besser nutzen und Informationsdefizite abbauen. EBR-Schulung bei luxemburgischer Privatbank Vom 8. bis 10. September 2025 traf sich der Europäische Betriebsrat der Quintet Private Bank in den Räumen der niederländischen Tochtergesellschaft InsingerGilissen in Den Haag (Foto), um die bevorstehende Sitzung mit der zentralen Leitung im Oktober 2025 vorzubereiten. Solche internen Vorbereitungssitzungen finden an wechselnden Standorten der beteiligten sechs Länder statt (inklusive des Vereinigten Königreichs). In Deutschland gehört die Privatbank Merck Finck zum Unternehmen, das sich im Besitz des ehemaligen Premierministers von Katar befindet. Insgesamt vertritt der EBR der Quintet Private Bank 2.000 Beschäftigte. In der Sitzung führte die EWC Academy eine Schulung über die verschiedenen Modelle der Arbeitnehmervertretung in Europa, über den korrekten Ablauf eines Konsultationsverfahrens und über die Änderungen der neuen EBR-Richtlinie durch. |
13. Aktuelle Seminartermine |
 |
|
Die EWC Academy und ihre Vorläuferorganisation führt seit Januar 2009 Tagungen und Seminare für Mitglieder von Europäischen Betriebsräten, SE-Betriebsräten und Besonderen Verhandlungsgremien durch. Bisher haben daran 981 Arbeitnehmervertreter aus 326 Unternehmen teilgenommen, viele von ihnen mehrfach. Das entspricht 25% aller transnationalen Betriebsratsgremien in Europa. Darunter sind auch 30 Unternehmen in der Rechtsform SE (Europäische Aktiengesellschaft). Hinzu kommen zahlreiche Inhouse-Veranstaltungen und Gastvorträge bei anderen Veranstaltern.
Überblick über die bevorstehenden Seminartermine Neuverhandlung von EBR-Vereinbarungen (kurzfristige Teilnahme noch möglich)
18. Hamburger Fachtagung für Europäische und SE-Betriebsräte
Grundlagenseminar auf Schloss Montabaur
Bericht von einem früheren Seminar in Montabaur Inhouse-Veranstaltungen
Beispiele für Inhouse-Seminare |
14. Impressum |
 |
|
Die EBR-News werden herausgegeben von: |
 |
 Vom 1. bis 3. Juli 2025 befaßte sich der High Court in Dublin in dritter Instanz mit dem Rechtsstreit des EBR im US-Unternehmen Verizon Communications (siehe
Vom 1. bis 3. Juli 2025 befaßte sich der High Court in Dublin in dritter Instanz mit dem Rechtsstreit des EBR im US-Unternehmen Verizon Communications (siehe  Am 28. Mai 2025 publizierten die europäischen Gewerkschaftsverbände in Brüssel ein Papier mit Empfehlungen für Europäische Betriebsräte und SE-Betriebsräte zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eine Richtlinie ("Corporate Sustainability Reporting Directive") für Unternehmen ab 500 Beschäftigten vorschreibt (siehe
Am 28. Mai 2025 publizierten die europäischen Gewerkschaftsverbände in Brüssel ein Papier mit Empfehlungen für Europäische Betriebsräte und SE-Betriebsräte zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eine Richtlinie ("Corporate Sustainability Reporting Directive") für Unternehmen ab 500 Beschäftigten vorschreibt (siehe  Am 25. Juli 2025 startete die Europäische Kommission die zweite Runde der Anhörungen der europäischen Sozialpartner hinsichtlich einer geplanten EU-Richtlinie über faire Telearbeit und das Recht auf Nichterreichbarkeit. Sie können ihre Stellungnahmen bis zum 6. Oktober 2025 abgeben. Danach wird die Europäische Kommission entscheiden, ob sie einen Gesetzentwurf vorlegt. Die erste Runde der Anhörungen endete im Juni 2024. Die Gewerkschaften fordern eine solche Richtlinie, die Arbeitgeberverbände betrachten sie als überflüssig (siehe
Am 25. Juli 2025 startete die Europäische Kommission die zweite Runde der Anhörungen der europäischen Sozialpartner hinsichtlich einer geplanten EU-Richtlinie über faire Telearbeit und das Recht auf Nichterreichbarkeit. Sie können ihre Stellungnahmen bis zum 6. Oktober 2025 abgeben. Danach wird die Europäische Kommission entscheiden, ob sie einen Gesetzentwurf vorlegt. Die erste Runde der Anhörungen endete im Juni 2024. Die Gewerkschaften fordern eine solche Richtlinie, die Arbeitgeberverbände betrachten sie als überflüssig (siehe  Am 10. Juni 2025 ist in Italien ein neues Gesetz in Kraft getreten, das verschiedene Aspekte der Arbeitnehmerbeteiligung regelt. Es ist ein historischer Wandel für das italienische Arbeitsrecht, denn es erlaubt erstmals die Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsrat und schafft steuerliche Anreize für eine Gewinnbeteiligung der Belegschaft. Weiterhin sieht es die Bildung von paritätischen Ausschüssen mit dem Management vor, um Vorschläge zur Verbesserung und Innovation von Produkten, Fertigungsprozessen, Dienstleistungen und der Arbeitsorganisation zu erarbeiten. Die Mitglieder von Aufsichtsräten und paritätischen Kommissionen erhalten einen Schulungsanspruch von zehn Stunden pro Jahr. Eine solche gesetzliche Regelung hatte es vorher noch nie gegeben.
Am 10. Juni 2025 ist in Italien ein neues Gesetz in Kraft getreten, das verschiedene Aspekte der Arbeitnehmerbeteiligung regelt. Es ist ein historischer Wandel für das italienische Arbeitsrecht, denn es erlaubt erstmals die Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsrat und schafft steuerliche Anreize für eine Gewinnbeteiligung der Belegschaft. Weiterhin sieht es die Bildung von paritätischen Ausschüssen mit dem Management vor, um Vorschläge zur Verbesserung und Innovation von Produkten, Fertigungsprozessen, Dienstleistungen und der Arbeitsorganisation zu erarbeiten. Die Mitglieder von Aufsichtsräten und paritätischen Kommissionen erhalten einen Schulungsanspruch von zehn Stunden pro Jahr. Eine solche gesetzliche Regelung hatte es vorher noch nie gegeben. Am 13. Juni 2025 brachten fünf Bundesländer, darunter vier mit sozialdemokratisch geführter Regierung und das konservativ-grün regierte Nordrhein-Westfalen, einen Antrag zur Überarbeitung des Betriebsverfassungsgesetzes in den Deutschen Bundesrat ein. Sie beziehen sie sich auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, die seit Mai 2025 amtiert (siehe
Am 13. Juni 2025 brachten fünf Bundesländer, darunter vier mit sozialdemokratisch geführter Regierung und das konservativ-grün regierte Nordrhein-Westfalen, einen Antrag zur Überarbeitung des Betriebsverfassungsgesetzes in den Deutschen Bundesrat ein. Sie beziehen sie sich auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, die seit Mai 2025 amtiert (siehe  Am 16. Juni 2025 legte das französische Forschungsinstitut CEET (Zentrum für Beschäftigungs- und Arbeitsstudien) eine empirische Studie über die Rolle und den Einfluss von Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsrat französischer Unternehmen vor. Es gibt sie in Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten in Frankreich oder 5.000 weltweit und sie stellen heute etwa 17% aller Mandate. Diese Regelung wurde 2013 in der Privatwirtschaft eingeführt und später ausgeweitet (siehe
Am 16. Juni 2025 legte das französische Forschungsinstitut CEET (Zentrum für Beschäftigungs- und Arbeitsstudien) eine empirische Studie über die Rolle und den Einfluss von Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsrat französischer Unternehmen vor. Es gibt sie in Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten in Frankreich oder 5.000 weltweit und sie stellen heute etwa 17% aller Mandate. Diese Regelung wurde 2013 in der Privatwirtschaft eingeführt und später ausgeweitet (siehe  Laut einer Prognose der Europäischen Kommission wächst die Wirtschaft der EU 2025 nur um 1,1%. Schlusslicht ist aktuell Österreich (-0,3%), Deutschland ist nur leicht besser mit 0,0%. An der Spitze stehen Malta (+4,1%), Dänemark (+3,6%) und Irland (+3,4%). Die niedrigste Arbeitslosenquote haben Malta mit 2,5%, Tschechien mit 3,0% und Polen mit 3,5%, Spanien liegt EU-weit an der Spitze mit 10,4%. Deutschland belegt mit 3,7% immer noch einen Spitzenplatz, Frankreich liegt mit 7,0% doppelt so hoch wie Deutschland. Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt jedoch eine Verschlechterung für Deutschland und eine Verbesserung für Frankreich, was schon 2024 begann (siehe
Laut einer Prognose der Europäischen Kommission wächst die Wirtschaft der EU 2025 nur um 1,1%. Schlusslicht ist aktuell Österreich (-0,3%), Deutschland ist nur leicht besser mit 0,0%. An der Spitze stehen Malta (+4,1%), Dänemark (+3,6%) und Irland (+3,4%). Die niedrigste Arbeitslosenquote haben Malta mit 2,5%, Tschechien mit 3,0% und Polen mit 3,5%, Spanien liegt EU-weit an der Spitze mit 10,4%. Deutschland belegt mit 3,7% immer noch einen Spitzenplatz, Frankreich liegt mit 7,0% doppelt so hoch wie Deutschland. Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt jedoch eine Verschlechterung für Deutschland und eine Verbesserung für Frankreich, was schon 2024 begann (siehe 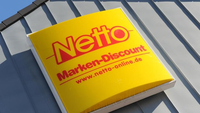 Am 25. April 2025 gab das Landesarbeitsgericht Niedersachsen in zweiter Instanz der Klage einiger Betriebsratsmitglieder von Netto Marken-Discount statt. Sie hatten die Einrichtung von persönlichen Mailadressen gefordert, die ihnen der Arbeitgeber verweigerte. Die Einzelhandelskette gehört zu Edeka und betreibt 4.400 Filialen mit 88.500 Beschäftigten und ist (nach Filialen) der größte Discounter Deutschlands vor Aldi und Lidl.
Am 25. April 2025 gab das Landesarbeitsgericht Niedersachsen in zweiter Instanz der Klage einiger Betriebsratsmitglieder von Netto Marken-Discount statt. Sie hatten die Einrichtung von persönlichen Mailadressen gefordert, die ihnen der Arbeitgeber verweigerte. Die Einzelhandelskette gehört zu Edeka und betreibt 4.400 Filialen mit 88.500 Beschäftigten und ist (nach Filialen) der größte Discounter Deutschlands vor Aldi und Lidl. Am 17. Juni 2025 lehnte das Kammergericht Berlin (Foto) den Antrag der Betriebsräte von N26 ab, einen Aufsichtsrat mit Drittelbeteiligung zu installieren. In Deutschland ist dies für Unternehmen zwischen 500 und 2.000 Beschäftigten vorgesehen. Die Betriebsräte der Direktbank mit Sitz in Berlin hatten im April 2024 ein Statusverfahren eingeleitet, weil dem Aufsichtsrat bisher keine Arbeitnehmervertreter angehören. In einem Statusverfahren entscheidet das Gericht über eine korrekte Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Auslöser dafür war die geplante Umwandlung der Bank in eine Europäische Gesellschaft (SE).
Am 17. Juni 2025 lehnte das Kammergericht Berlin (Foto) den Antrag der Betriebsräte von N26 ab, einen Aufsichtsrat mit Drittelbeteiligung zu installieren. In Deutschland ist dies für Unternehmen zwischen 500 und 2.000 Beschäftigten vorgesehen. Die Betriebsräte der Direktbank mit Sitz in Berlin hatten im April 2024 ein Statusverfahren eingeleitet, weil dem Aufsichtsrat bisher keine Arbeitnehmervertreter angehören. In einem Statusverfahren entscheidet das Gericht über eine korrekte Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Auslöser dafür war die geplante Umwandlung der Bank in eine Europäische Gesellschaft (SE).
 Am 26. Juni 2025 wurde in Paris auf einer Sitzung des SE-Betriebsrats eine Rahmenvereinbarung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für die 63.000 Angestellten des französischen Pflegeheimbetreibers Clariane unterzeichnet. Sie definiert einen europaweiten Rahmen, um Risiken am Arbeitsplatz zu vermeiden und Zugang zu Schutzausrüstungen und Schulungen zu gewährleisten. So sollen Unfälle und Fehlzeiten in allen Clariane-Standorten reduziert werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Betriebsräte auf lokaler Ebene. Für die Überwachung der Vereinbarung wird eine paritätische Kommission gebildet, die spezielle Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren, Unfalldaten, Fehlzeiten und Maßnahmen in den einzelnen Ländern bewertet. Sie trifft sich zweimal im Jahr, einmal davon außerhalb Frankreichs. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung hatten im April 2025 begonnen (siehe
Am 26. Juni 2025 wurde in Paris auf einer Sitzung des SE-Betriebsrats eine Rahmenvereinbarung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für die 63.000 Angestellten des französischen Pflegeheimbetreibers Clariane unterzeichnet. Sie definiert einen europaweiten Rahmen, um Risiken am Arbeitsplatz zu vermeiden und Zugang zu Schutzausrüstungen und Schulungen zu gewährleisten. So sollen Unfälle und Fehlzeiten in allen Clariane-Standorten reduziert werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Betriebsräte auf lokaler Ebene. Für die Überwachung der Vereinbarung wird eine paritätische Kommission gebildet, die spezielle Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren, Unfalldaten, Fehlzeiten und Maßnahmen in den einzelnen Ländern bewertet. Sie trifft sich zweimal im Jahr, einmal davon außerhalb Frankreichs. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung hatten im April 2025 begonnen (siehe  Am 1. April 2025 wurde am Sitz von Lonza in Basel (Foto) eine neue EBR-Vereinbarung geschlossen. Der EBR besteht seit 2009 und er arbeitet nach spanischem Recht. Größtes Land ist die Schweiz mit 6.800 Beschäftigten und drei Delegierten im EBR, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 1.400 Beschäftigten und zwei Sitzen. Hinzu kommen fünf EU-Länder mit 2.300 Beschäftigten und sieben Mandaten. Jedes Jahr finden zwei reguläre EBR-Sitzungen statt, eine davon als Videokonferenz. Drei Delegierte aus drei verschiedenen Ländern bilden den geschäftsführenden Ausschuss. Im Fall von außergewöhnlichen Umständen führt er Sondersitzungen durch und lädt Delegierte aus allen betroffenen Ländern ein.
Am 1. April 2025 wurde am Sitz von Lonza in Basel (Foto) eine neue EBR-Vereinbarung geschlossen. Der EBR besteht seit 2009 und er arbeitet nach spanischem Recht. Größtes Land ist die Schweiz mit 6.800 Beschäftigten und drei Delegierten im EBR, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 1.400 Beschäftigten und zwei Sitzen. Hinzu kommen fünf EU-Länder mit 2.300 Beschäftigten und sieben Mandaten. Jedes Jahr finden zwei reguläre EBR-Sitzungen statt, eine davon als Videokonferenz. Drei Delegierte aus drei verschiedenen Ländern bilden den geschäftsführenden Ausschuss. Im Fall von außergewöhnlichen Umständen führt er Sondersitzungen durch und lädt Delegierte aus allen betroffenen Ländern ein. Am 14. April 2025 wurde für das börsennotierte, familiengeführte Unternehmen Bouygues in Paris eine EBR-Vereinbarung geschlossen, die die bisherige von März 2021 ersetzt (siehe
Am 14. April 2025 wurde für das börsennotierte, familiengeführte Unternehmen Bouygues in Paris eine EBR-Vereinbarung geschlossen, die die bisherige von März 2021 ersetzt (siehe  Am 3. Juli 2025 konstituierte sich in Berlin (Foto) der neue EBR von The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Die Tochtergesellschaft des britischen Unilever-Konzerns mit 19.000 Beschäftigten hat am 1. Juli 2025 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Bis November 2025 soll der größte Speiseeis-Hersteller der Welt an die Börse gebracht werden. Der EBR von Unilever und die zentrale Leitung hatten zuvor die Bildung eines Spartenbetriebsrates Eiscreme vereinbart, der nach dem Börsengang als vollwertiger EBR nach niederländischem Recht weiterarbeiten wird. Die EBR-Vereinbarung von Unilever wurde weitgehend unverändert für Magnum übernommen. Damit konnte eine lange Phase mit einem Besonderen Verhandlungsgremium und ohne EBR vermieden werden. An der Vorbereitung der EBR-Gründung war die EWC Academy als Beraterin beteiligt (siehe
Am 3. Juli 2025 konstituierte sich in Berlin (Foto) der neue EBR von The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Die Tochtergesellschaft des britischen Unilever-Konzerns mit 19.000 Beschäftigten hat am 1. Juli 2025 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Bis November 2025 soll der größte Speiseeis-Hersteller der Welt an die Börse gebracht werden. Der EBR von Unilever und die zentrale Leitung hatten zuvor die Bildung eines Spartenbetriebsrates Eiscreme vereinbart, der nach dem Börsengang als vollwertiger EBR nach niederländischem Recht weiterarbeiten wird. Die EBR-Vereinbarung von Unilever wurde weitgehend unverändert für Magnum übernommen. Damit konnte eine lange Phase mit einem Besonderen Verhandlungsgremium und ohne EBR vermieden werden. An der Vorbereitung der EBR-Gründung war die EWC Academy als Beraterin beteiligt (siehe  Seit dem 24. Juni 2025 firmiert Brainlab mit Sitz in München als Europäische Gesellschaft (SE). Der weltweite Marktführer für softwaregestützte Technologien in der Chirurgie hat weltweit 2.000 Beschäftigte, davon knapp 1.600 in Deutschland, wo es bisher noch keinen Betriebsrat gibt. Daher wird der künftige SE-Betriebsrat eine besondere Rolle spielen. Die Vertreter im Besonderen Verhandlungsgremium aus Deutschland, Frankreich und Italien ließen sich für ihre Aufgabe von der EWC Academy schulen (Foto).
Seit dem 24. Juni 2025 firmiert Brainlab mit Sitz in München als Europäische Gesellschaft (SE). Der weltweite Marktführer für softwaregestützte Technologien in der Chirurgie hat weltweit 2.000 Beschäftigte, davon knapp 1.600 in Deutschland, wo es bisher noch keinen Betriebsrat gibt. Daher wird der künftige SE-Betriebsrat eine besondere Rolle spielen. Die Vertreter im Besonderen Verhandlungsgremium aus Deutschland, Frankreich und Italien ließen sich für ihre Aufgabe von der EWC Academy schulen (Foto). Am 24. Juli 2025 wurde die HanseMerkur Holding als Europäische Gesellschaft (SE) im Handelsregister eingetragen. Damit konnte die zentrale Leitung fast "in letzter Sekunde" die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat vermeiden. Es fehlten nur noch 77 Angestellte, um die Schwelle von 2.000 zu erreichen, ab der das deutsche Mitbestimmungsgesetz einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat vorschreibt. Mit der SE-Umwandlung ist dies auf Dauer ausgeschlossen. Neben den knapp 2.000 Angestellten in Deutschland gibt es lediglich 59 in vier anderen europäischen Ländern, davon 42 in Liechtenstein. In zwei Tochtergesellschaften sind die Aufsichtsräte heute schon zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern besetzt und bleiben erhalten. Am 16. Mai 2025 unterzeichnete das Besondere Verhandlungsgremium eine SE-Beteiligungsvereinbarung.
Am 24. Juli 2025 wurde die HanseMerkur Holding als Europäische Gesellschaft (SE) im Handelsregister eingetragen. Damit konnte die zentrale Leitung fast "in letzter Sekunde" die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat vermeiden. Es fehlten nur noch 77 Angestellte, um die Schwelle von 2.000 zu erreichen, ab der das deutsche Mitbestimmungsgesetz einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat vorschreibt. Mit der SE-Umwandlung ist dies auf Dauer ausgeschlossen. Neben den knapp 2.000 Angestellten in Deutschland gibt es lediglich 59 in vier anderen europäischen Ländern, davon 42 in Liechtenstein. In zwei Tochtergesellschaften sind die Aufsichtsräte heute schon zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern besetzt und bleiben erhalten. Am 16. Mai 2025 unterzeichnete das Besondere Verhandlungsgremium eine SE-Beteiligungsvereinbarung. Am 1. August 2025 wurde das Familienunternehmen Winkhaus aus Telgte (Münsterland) als Europäische Gesellschaft (SE) im Handelsregister eingetragen. Die Unternehmensgruppe hat 2.300 Beschäftigte, davon 1.300 in Deutschland und produziert Fenstertechnik und Türverriegelungen. Die SE-Umwandlung erfolgte nach deutschem Recht, dennoch gehörte kein Mitglied aus Deutschland dem Besonderen Verhandlungsgremium an, weil zu diesem Zeitpunkt nur ausländische Tochtergesellschaften zur SE gehörten. Es bestand aus 16 Delegierten, davon neun aus Polen.
Am 1. August 2025 wurde das Familienunternehmen Winkhaus aus Telgte (Münsterland) als Europäische Gesellschaft (SE) im Handelsregister eingetragen. Die Unternehmensgruppe hat 2.300 Beschäftigte, davon 1.300 in Deutschland und produziert Fenstertechnik und Türverriegelungen. Die SE-Umwandlung erfolgte nach deutschem Recht, dennoch gehörte kein Mitglied aus Deutschland dem Besonderen Verhandlungsgremium an, weil zu diesem Zeitpunkt nur ausländische Tochtergesellschaften zur SE gehörten. Es bestand aus 16 Delegierten, davon neun aus Polen. Am 14. Mai 2025 wurde in Kopenhagen eine Vereinbarung zwischen der Konzernleitung von Arla Foods und der IUL, dem weltweiten Verband der Lebensmittelgewerkschaften mit Sitz in einem Vorort von Genf, geschlossen. Darin sind die Achtung der Menschenrechte, ein verantwortungsbewusstes Handeln und die unternehmerische Sorgfaltspflicht geregelt. Sie baut auf einer Vereinbarung zur Bekämpfung sexueller Belästigung vom Oktober 2019 auf (siehe
Am 14. Mai 2025 wurde in Kopenhagen eine Vereinbarung zwischen der Konzernleitung von Arla Foods und der IUL, dem weltweiten Verband der Lebensmittelgewerkschaften mit Sitz in einem Vorort von Genf, geschlossen. Darin sind die Achtung der Menschenrechte, ein verantwortungsbewusstes Handeln und die unternehmerische Sorgfaltspflicht geregelt. Sie baut auf einer Vereinbarung zur Bekämpfung sexueller Belästigung vom Oktober 2019 auf (siehe  Am 18. Juni 2025 legte der weltweite Dachverband der Gewerkschaften der Dienstleistungsbranche (UNI Global) einen Bericht über Moderatoren von Inhalten in sozialen Netzwerken vor. Zu den Aufgaben eines Content-Moderators zählen das Löschen und Sperren von Inhalten im Auftrag von Tech-Konzernen wie Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta und Microsoft. Ihre Tätigkeit wird im Rahmen des Business Process Outsourcing (BPO) oft an weltweit tätige Unternehmen wie Accenture, Concentrix, Telus Digital und Teleperformance ausgelagert, die entsprechende Arbeitsplätze vorwiegend in Niedriglohnländern konzentrieren (siehe
Am 18. Juni 2025 legte der weltweite Dachverband der Gewerkschaften der Dienstleistungsbranche (UNI Global) einen Bericht über Moderatoren von Inhalten in sozialen Netzwerken vor. Zu den Aufgaben eines Content-Moderators zählen das Löschen und Sperren von Inhalten im Auftrag von Tech-Konzernen wie Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta und Microsoft. Ihre Tätigkeit wird im Rahmen des Business Process Outsourcing (BPO) oft an weltweit tätige Unternehmen wie Accenture, Concentrix, Telus Digital und Teleperformance ausgelagert, die entsprechende Arbeitsplätze vorwiegend in Niedriglohnländern konzentrieren (siehe 





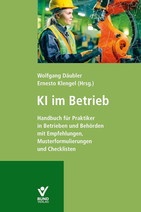





 Vom 7. bis 10. Oktober 2025 findet das jährliche juristische Seminar im Schloss Steinburg in Würzburg statt. Die neue EBR-Richtlinie wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 noch verabschiedet. Da die neuen Standards nicht in allen Fällen automatisch greifen, muss eine große Zahl von EBR-Vereinbarungen angepasst werden. Dafür gelten besondere Regelungen und die Verhandlungszeit ist auf zwei Jahre begrenzt. In diesem Seminar werden die kritischen Punkte behandelt, um sich darauf vorzubereiten.
Vom 7. bis 10. Oktober 2025 findet das jährliche juristische Seminar im Schloss Steinburg in Würzburg statt. Die neue EBR-Richtlinie wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 noch verabschiedet. Da die neuen Standards nicht in allen Fällen automatisch greifen, muss eine große Zahl von EBR-Vereinbarungen angepasst werden. Dafür gelten besondere Regelungen und die Verhandlungszeit ist auf zwei Jahre begrenzt. In diesem Seminar werden die kritischen Punkte behandelt, um sich darauf vorzubereiten.
 Vom 7. bis 10. April 2026 findet wieder das jährliche Grundlagenseminar für die Mitglieder von Europäischen Betriebsräten, SE-Betriebsräten und Besonderen Verhandlungsgremien in Montabaur statt. Das Schloss liegt am ICE-Bahnhof auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Köln. Dort werden mehrere Seminarbausteine für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten.
Vom 7. bis 10. April 2026 findet wieder das jährliche Grundlagenseminar für die Mitglieder von Europäischen Betriebsräten, SE-Betriebsräten und Besonderen Verhandlungsgremien in Montabaur statt. Das Schloss liegt am ICE-Bahnhof auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Köln. Dort werden mehrere Seminarbausteine für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten.